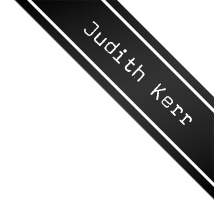DIE PREISTRÄGER:INNEN
Die Preisverleihung fand am Pfingstmontag, 20. Mai 2024 um 12.00 Uhr im Haus der Berliner Festspiele statt.
Der Alfred–Kerr–Darstellerpreis geht in diesem Jahr an
Er erhielt den Preis für seine schauspielerische Leistung in der Inszenierung „Die Hundekot-Attacke“ vom Theaterhaus Jena in Koproduktion mit Wunderbaum.

Nikita Buldyrski wurde 1995 in Neftekumsk (Russland) geboren. Nach seinem Umzug nach Deutschland wohnte er in Bochum und sammelte dort schon früh Theatererfahrungen in russisch- und deutschsprachigen Projekten.
Es folgten diverse Produktionen in der umliegenden Freien Szene, beispielsweise am ROTTSTR 5 THEATER in Bochum. Auch arbeitete er in einigen Produktionen am Jungen Schauspielhaus und am Schauspielhaus Bochum.
Von 2018 bis 2022 absolvierte er anschließend seine Schauspielausbildung an der Universität Mozarteum Salzburg. Vor und während des Studiums hat er mit Alexander Riemenschneider, Tina Lanik, Jörg Lichtenstein, Amélie Niermeyer, Anja Herden und Joachim Gottfried Goller zusammengearbeitet.
Anfang 2022 war er unter der Regie von Ebru Tartıcı Borchers in der Uraufführung von „KNECHTE“ (Caren Jeß) am Kosmos Theater Wien zu sehen. Seit der Spielzeit 2022/23 ist er Ensemblemitglied am Theaterhaus Jena. Hier spielte er u. a. in „Die Hundekot-Attacke“ unter der Regie von Walter Bart (Wunderbaum).
Nikita Buldyrski schreibt Texte und macht in seiner Freizeit Rapmusik. Am Theaterhaus Jena nutzte er dies unter anderem für die Arbeit an „On the Edge“, seinem ersten selbstentwickelten Solo-Stück.
Liebe Alle,
als erstes möchte ich der Kerr-Gesellschaft und insbesondere Torsten Maß, Peter Boehme und Peter von Becker für die mir anvertraute Aufgabe danken, den Alfred-Kerr-Preis zu vergeben.
Die drei Königinnen des diesjährigen Theatertreffens, Lina Beckmann, Wiebke Puls und Valerie Tscheplanowa sind alle Preisträgerinnen des Alfred-Kerr-Preises. Das sagt sehr viel über seine Bedeutung und auch über den Spürsinn meiner Juroren-Vorgänger und -Vorgängerinnen aus.
Ich war sowohl 2020 als auch 2021 als Kerr-Jurorin angefragt. Beide Male wurde der Preis pandemiebedingt nicht vergeben, weil die Theatertreffen nur gestreamt wurden, der Kerr-Preis aber explizit ein Theaterpreis ist und die Aufzeichnung einer Aufführung allenfalls ihr Zitat.
Beide Male hatte ich schon über eine mögliche Preisträgerin nachgedacht. Die Tänzerin Beatrice Cordua in Florentina Holzingers Abend „Tanz“ hatte mich schlicht sprachlos gemacht. Ihr Sich-selbst-Aussetzen, ihr beißender Humor, ihre Klarheit, ihre Coolness und Eleganz. Gut, sie ist um die 80 Jahre alt, egal, dachte ich, es ist ihre erste Sprechrolle, sie ist Nachwuchs, wie man ihn sich potenter nicht wünschen kann. 2021 war es die Performerin Lucy Wilke, in die ich mich geradezu schockverliebte. Ihr Abend „Scores that shaped our Friendship“ ist in seiner hochreflektierten Intimität ein liebevoller Tabubruch. Zwei Menschen mit so verschiedenen Körpern, der eine von spinaler Atrophie, der andere vom Tanz geformt und geprägt, treten in einen Dialog, berühren sich, tanzen und werden getanzt, sind in jedem Augenblick mutig und anmutig zugleich.
Beide Darstellerinnen, beide Abende, waren verstörend, betörend, bestürzend, sie haben meine Art, die Welt wahrzunehmen aufs Produktivste gestört, haben meine Weltsicht erweitert. Ich werde sie nie vergessen und wollte dieses Forum nutzen, sie nochmal in Erinnerung zu rufen und mich für die Performance der beiden Darstellerinnen zu bedanken.
Ich bin ja keine Kritikerin und kann mir deshalb erlauben, nur von den Momenten zu berichten, die mich am diesjährigen Theatertreffen berührt haben, die mich begeisterten. Ich habe ausdrücklich nicht den Wunsch, den Inszenierungen oder der Stückauswahl als Ganzes gerecht zu werden.
Als in „Riesenhaft in Mittelerde“ zu Beginn des Stückes sich diese vielen Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, gegenüberstehen, einander in die Augen schauen, aufeinander zugehen und gemeinsam singen: „Die Welt ist im Wandel, die Welt ist im Wandel“, war es um mich geschehen. Ja! Genau! Wie gut! Hoffentlich ist sie das! Hier und in diesem Augenblick auf jeden Fall ist sie das.
Überhaupt immer wieder die Darsteller*innen des Theater Hora. Welche Hingabe, welcher Genuss am Auftritt. Sie wollen etwas erleben. Es ist ja nicht nur die Lebenszeit der Zuschauenden, für uns Spielende ist es auch unsere eigene Lebenszeit, die abläuft, während wir auf der Bühne stehen. Warum also Bescheidenheit? Warum sich begnügen mit der Bewältigung von oft so übersichtlich komplexen Aufgaben? Warum Schonung? Sowohl von uns selbst als auch vom Publikum?
Bei „Silence“ traf mich der Moment, als ich begriff, dass es dem Sohn nicht möglich sein wird, die Dinge mit seiner Mutter zu klären. Dass es ihre Überlebensstrategie ist, die Verletzungen – sowohl die selbst erlittenen wie auch die anderen Menschen zugefügten – unter Verschluss zu halten und dass das gewaltsame Herausholen derselben sie zerstören würde. Dem Sohn bleibt nur die Kapitulation, aber in ihr liegt eine Schönheit, denn sie führt vielleicht in eine neue Freiheit, die im Verzeihen statt im Klären liegt. Während ich Dimitrij Schaad als Falk Richter beim Sich-Erinnern an seine Kindheit und Jugend zusah, konnte ich erleben, dass Erinnern nichts Rückwärtsgewandtes ist, sondern eine Form des Werdens.
Wenn Wiebke Puls‘ Anna Petrowna in „Die Vaterlosen“ die Sinnlosigkeit ihres zur Untätigkeit verurteilten Lebens als Frau in den Abgrund ihres weinerlichen Stiefsohnes hineinschreit, ist es ein Moment großer Klugheit und Emotionalität. Zwei Begriffe, die oft als sich gegenseitig ausschließend gesehen werden. Aber nicht nur das Denken, auch die Emotion ist ein Erkenntnisinstrument. Auch auf der Bühne. Ich kann durch die Emotion Dinge begreifen und begreifbar machen, die jenseits eines klugen Gedankens sind. So kann ich mir selbst und dem Publikum ermöglichen, in eine Figur hineinzuschauen, statt sie lediglich zu durchschauen, was ja wohl das Langweiligste überhaupt ist.
Zwei der drei großen Protagonistinnen des Theatertreffens spielen Männer, Nathan und Laios. Ich habe auch des Öfteren Männer gespielt, tolle Figuren, widersprüchlich, unbequem, irritierend. Und doch hat es etwas von Notwehr, als Frau immer wieder Männerfiguren zu spielen. Ich würde mir wünschen, dass der Prozess der Entwicklung von genauso ambivalenten, vielschichtigen und verwirrenden weiblichen Figuren mehr an Fahrt aufnimmt. Es ist mühsam festzustellen, wie hartnäckig sich die tradierten und eben unrealistisch einseitigen Frauenfiguren im Spielplan halten, ärgerlicherweise werden sie zuweilen auch von Regisseurinnen reproduziert.
Manchmal wird man im Theater ein wenig zu sehr an die Hand genommen und durch gut gangbares Gelände geführt. Etwas zu oft entsteht das Gefühl, auf der Höhe der Handlung zu sein und nicht unbedingt in unbekannte Höhen und Tiefen vorzudringen. Doch mit „Bucket List“ wird man nicht so schnell fertig. Ich sah die Zersplitterung des Individuums angesichts der Katastrophe in seine Einzelteile, von denen doch viele so demütigend banal und beschämend kleinlich sind. In ein beklemmendes Gefühl der Verlorenheit gestoßen hatte ich zugleich einen großen Genuss an der fantastischen Musikalität der Beteiligten, an ihrem schieren Können, an ihrer Kunst und Fähigkeit zur Abstraktion. In diesem Widerspruch liegt die Kraft dieses Abends.
Wir sind alle Verstrickte. Verstrickt in unsere private Geschichte, unsere Familie, unseren Alltag, verstrickt in die politische und gesellschaftliche Gegenwart, in die wir zufälligerweise geworfen sind. Wir Schauspieler*innen sind zusätzlich noch verstrickt im Realitätsverzerrungsfeld des Theaters mit seinen Macht-, Verteilungs- und Statuskämpfen. Das Theater ist ein Ort, an dem Freiheit oft Thema und selten Praxis ist. Wenn es uns gelingt, für Momente all das hinter uns zu lassen oder zumindest zur Seite zu treten und uns frei auf einer Bühne zu bewegen, hat das schon etwas Utopisches. Um Nietzsche zu zitieren: „Frei ist, wer in Ketten tanzen kann.“ Wenn die drei Tänzer-Performer in „Extra Life“ im gleißenden Licht des Schlussbildes in ihrer unerbittlichen Langsamkeit trotz aller traumatischen Erfahrungen tanzend beinahe abheben, erreichen sie für Augenblicke diese Utopie.
In „Die Hundekot-Attacke“ verstand ich plötzlich, dass es hier nicht allein um einen Diskurs über das Verhältnis von Kritik und Kunst und um Machtstrukturen am Theater geht, sondern um den Überlebenskampf einer Handvoll Künstler*innen. Um im Angesicht der drohenden Arbeitslosigkeit aufgrund des bevorstehenden Leitungswechsels am Theaterhaus Jena die Aufmerksamkeit der Kritik auf sich zu ziehen, machen sie einen Abend über Kritiker*innen. Nicht nur Schauspieler*innen, alle Menschen lieben es, wenn über sie gesprochen wird, wenn sich jemand mit ihnen beschäftigt – die Rechnung ging auf, das Stück ist eine Erfolgsgeschichte, das Problem der Unsichtbarkeit in der sogenannten Provinz clever und charmant gelöst.
Wie Pina Bergemann und Leon Pfannenmüller in quälenden Wiederholungen aus Theater-Kritiken die für sie verletzendsten Sätze vorlesen, ist von herzzerreißender Komik und ich musste an eine meiner Lieblingsgeschichten über das Theater denken: Ein australischer Mythos erzählt von einem berghohen Frosch, der das Meer und alle Wasser der Welt verschluckt hatte. Die Fische und alle anderen Wassertiere zappelten auf dem Trockenen. Da fing ein Aal an, auf seiner Schwanzspitze zu balancieren und bestimmt mit einer recht verzweifelten Würde vor dem Frosch auf und ab zu spazieren, bis dieser lachend zusammenbrach und das ganze Wasser wieder ausspuckte. Die Spieler*innen des Theaterhauses Jena sind die Kolleg*innen dieses Aales.
Es muss immer um etwas gehen, immer! Ganz gleich, ob es mit Leichtigkeit, mit Humor, mit großem Ernst, in Düsternis erzählt wird. Es muss etwas auf dem Spiel stehen.
Und jetzt zur Hauptsache. Auszeichnen möchte ich einen jungen Schauspieler, der mir in seiner präzisen Natürlichkeit auffiel, dessen Spiel etwas bestechend Selbstverständliches hat. Es ist Nikita Buldyrski aus „Die Hundekot-Attacke“. Lange Zeit schauen wir ihm beim Zuhören zu. Und er kann zuhören. Er will nicht nur sich selbst Gehör verschaffen und lässt so kein Wort der anderen zu Boden fallen. Über weite Strecken liest er ab, aber nichts daran ist statisch, sein Blick ist klar und offen, man vergisst das Blatt in seiner Hand; in einer entspannten Konzentration und Präsenz bewahrt er sich eine innere Beweglichkeit in dieser deutlichen formalen Setzung. Er sitzt da in einer kraftvollen Ruhe, aus der sich immer wieder starke emotionale Eruptionen ereignen. Spricht er, ist jeder Satz ein Treffer, Nikita braucht keinen Anlauf, kein Hineinfummeln in die Situation, er betritt sie mit großer Leichtigkeit, Direktheit und Entschlossenheit, er ist sofort zu 100 Prozent da, wie ein Licht, das man einschaltet. Ich hatte gleich Lust, auf die Bühne zu springen und mit ihm zu spielen. Sein Spiel ist pure Gegenwart. Es gibt keine Zeit mehr, nur Augenblick für Augenblick Buldyrski. In seinem Rap gegen Ende des Abends zeigt er sich ganz und gar, klagt an, teilt aus und ist dabei verletzbar und selbstbewusst zugleich. Nikita lässt uns in seine Wut schauen und agiert mit dieser verzweifelten Würde, bei der klar ist, dass es hier um etwas geht und nicht um nichts.
Herzlichen Glückwunsch Nikita Buldyrski!
Jurorin des Alfred-Kerr-Darstellerpreises 2024 war die renommierte Theater- und Filmschauspielerin Ursina Lardi.

Ursina Lardi wurde in Graubünden in der Schweiz geboren. Ihr Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ führte sie nach Berlin.
Im Rahmen ihres ersten Engagements am Düsseldorfer Schauspielhaus spielte sie in der Regie von Einar Schleef die Titelrolle in Oscar Wildes „Salome“ (eingeladen zum Theatertreffen 1998).
Nach Engagements an mehreren renommierten Häusern in Deutschland ist Ursina Lardi seit 2012 Ensemblemitglied an der Schaubühne Berlin und ist dort zur Zeit in „Everywoman“ und in „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ in der Regie von Milo Rau, in „Die Ehe der Maria Braun“ in der Regie von Thomas Ostermeier und in „Bad Kingdom“ von Falk Richter zu sehen.
Als Gast spielte und sang Ursina Lardi an der Staatsoper Berlin die Elsa in „Lohengrin“ von Salvatore Sciarrino (Regie Ingo Kerkhof, 2014).
Außerhalb der Schaubühne ist sie seit vielen Jahren in den Produktionen von Thorsten Lensing zu sehen, zuletzt in „Unendlicher Spaß“ von David Foster Wallace (Theatertreffen 2019) und in „Verrückt nach Trost“ (Salzburger Festspiele 2022).
Ursina Lardi ist neben ihrer Theaterarbeit in zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen zu sehen, u. a. in „Das weiße Band“ von Michael Haneke (Goldene Palme in Cannes und Oscar-Nominierung), „Lore“ von Cate Shortland (Deutscher Filmpreis 2013), „Sag mir nichts“ von Andreas Kleinert und in „Der namenlose Tag“ von Volker Schlöndorff.
Letztes Jahr hatte sie in Cannes Premiere mit „La dérive des continents (au sud)“ von Lionel Baier und war in Axel Ranischs Opernfilm „Orphea in Love“ und in Sabine Boss Komödie „Die Nachbarn von oben“ im Kino zu sehen. Für „Die Nachbarn von oben“ ist sie aktuell für den Schweizer Filmpreis nominiert.
In diesem Jahr feierte der Film „Veni Vidi Vici“ von Daniel Hoesl mit ihr in einer der Hauptrollen im Internationalen Wettbewerb des Sundance Film Festival Premiere.
2014 gewann Ursina Lardi den Schweizer Filmpreis als beste Darstellerin in Petra Volpes Film „Traumland“. 2017 erhielt sie den Grand Prix Theater und den Hans-Reinhart-Ring, die höchste Theaterauszeichnung der Schweiz.
Die Preisverleihung fand am Pfingstmontag, 29. Mai im Haus der Berliner Festspiele u. a. in Anwesenheit von George Alfred Kerr (Urenkel von Alfred Kerr) statt.
Der mit 5.000 Euro dotierte Alfred–Kerr–Darstellerpreis 2023 geht an
Er erhält den Preis für seine schauspielerische Leistung in der Inszenierung „Kinder der Sonne“ in der Regie von Mateja Koležnik am Schauspielhaus Bochum.

Dominik Dos-Reis, geboren 1993 in Niederösterreich, aufgewachsen in Österreich und Frankreich, studierte Philosophie sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien.
Von 2015 bis 2019 absolvierte er sein Schauspielstudium an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK).
Gastengagements führten ihn 2017 an das Burgtheater Wien, wo er in Radetzkymarsch (Regie: Johan Simons) spielte. Neben seinen Rollen am Theater wirkte er in diversen Filmproduktionen mit.
Seit der Spielzeit 2018/19 ist er Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum.
Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreises 2023 war der Schauspieler Edgar Selge.

Edgar Selge ist einer der bedeutendsten deutschsprachigen Theater- und Filmschauspieler.
Geboren wurde er 1948 in Brilon im Sauerland. Er studierte Philosophie und Germanistik in München und Dublin sowie klassisches Klavier in Wien. Nach Abschluss der Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München engagierte ihn Hans Lietzau ans Schiller Theater in Berlin. Anschließend spielte er fast 20 Jahre lang an den Münchner Kammerspielen, wo er mit Regisseuren wie Dieter Dorn, Robert Wilson, George Tabori, Thomas Langhoff und Franz Xaver Kroetz zusammenarbeitete.
Wiederholt war er mit Aufführungen zum Theatertreffen eingeladen, u. a. spielte er in „Die goldenen Fenster“ (Regie: Robert Wilson), „Der Drang“ (Regie: Franz Xaver Kroetz), „Emilia Galotti“ (Regie: Thomas Langhoff) und „Oleanna“ (Regie: Jens-Daniel Herzog).
Neben seiner Bühnentätigkeit steht Edgar Selge auch vor der Kamera und wirkte in knapp 100 Film- und Fernsehproduktionen mit. Unvergessen seine fulminanten Szenen in Helmut Dietls „Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“ oder im Kinofilm „Poll“ von Chris Kraus – neben ihm die damals noch unbekannte Paula Beer.
Von seinen etwa 20 Auszeichnungen seien drei theaterspezifische hier erwähnt:
Für seine Rolle des Universitätsdozenten François in der Romanadaption „Unterwerfung“ von Michel Houellebecq in der Regie von Karin Beier am Deutschen SchauSpielHaus Hamburg wurde er in der Kritiker*innenumfrage von Theater heute zum Schauspieler des Jahres 2016 gekürt und mit dem Deutschen Theaterpreis Der Faust sowie dem Theaterpreis Hamburg – Rolf Mares ausgezeichnet.
2021 erschien sein literarisches Debut „Hast du uns endlich gefunden“ im Rowohlt Verlag. Der autofiktionale Roman stand monatelang auf den Bestsellerlisten und wurde von der Kritik gefeiert.
Die Preisverleihung findet am Pfingstmontag, den 29. Mai 2023, als Matinée im Haus der Berliner Festspiele statt. Der Eintritt ist frei.
Der Alfred–Kerr–Darstellerpreis 2022 geht an Samouil Stoyanov für seine schauspielerische Leistung in der Inszenierung „humanistää!“ (Regie von Claudia Bauer) am Wiener Volkstheater.
Die Preisverleihung fand am 22. Mai 2022 im Haus der Berliner Festspiele statt.

Der gebürtige Bulgare Samouil Stoyanov (*1989) wuchs in Linz auf, wo seine Eltern eine Ballettschule betreiben. Bereits in seiner Kindheit stand er als Tänzer, Musiker und Amateurschauspieler auf der Bühne.
Er erhielt Unterricht in den Sparten Ballett, Jazztanz, Stepptanz, Flamenco und Modern Dance und arbeitete in der familieneigenen Theaterballettschule MAESTRO als Bühnenbildner und Lichttechniker.
Nach regelmäßigen Jugendtheaterworkshops am Wörthersee, bei denen er mit gehörbehinderten Kindern arbeitete, begann er 2011 sein Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar in Wien. Erste Engagements folgten bereits während des Studiums. Nach seinem Abschluss erhielt er Angebote von 18 Theatern und entschied sich für die Münchner Kammerspiele, deren Ensemble er von 2015 bis 2020 angehörte. Seit der Spielzeit 2020/21 ist Samouil Stoyanov Ensemblemitglied am Volkstheater in Wien.
2018 erhielt er den Förderpreis der Freunde der Münchner Kammerspiele und im gleichen Jahr den Kunstförderpreis in der Sparte „Darstellende Kunst” der Bayerischen Landesregierung.
Verehrtes Publikum, verehrtes Kerrpreis- und Theatertreffenteam!
Zehn Aufführungen durfte ich sehen und zehnmal Mal durfte ich staunen. Als erstes staunte ich über das immer noch lebendige Pointen- und Timinghandwerk und das Ineinanderzahnen von jungen und alten Theatermachenden, die sich genüsslich die Butter vom Brot nehmen im Dresdner „Tartuffe“. Ich staunte über die bescheidene und unmittelbare Bereitschaft, eine Geschichte zu erzählen wie in „Ein Mann seiner Klasse“ (Hannover).
Ich staunte über die filigrane japanische Miniatur „Doughnuts“ (Thalia Theater Hamburg), in die eine Handvoll Europäer gestopft war wie in eine Sardinendose und die dort sehr verwundert und vergnüglich um Pointen rangen, und ich staunte darüber, dass das gemeinsame Lesen eines Textes ein Theatervorgang sein kann wie in „All right. Good night“ von Rimini Protokoll. Auch über die unzähligen kleinen, verwinkelten Wendungen, Sackgassen, Umwege und Abzweigungen in „Das neue Leben“ (Bochum) staunte ich, noch mehr aber, dass den Bärenanteil an Bühnenzeit nicht Menschen, sondern eine kreisende Lampe bekam.
Dann staunte ich auch über mich. Ich war nicht in der Lage mich von mir fremden Schauspieler:innen anfassen zu lassen und Anweisungen zu befolgen, auch wenn ich eine Karte gekauft hatte, die diesen Vorgang als Theateraufführung beschreibt. Ich verließ „Die Ruhe“ (Schauspielhaus Hamburg) nach drei Stunden.
Schließlich staunte ich darüber, dass mir manche Theatermachende so vorkamen, als säßen sie noch immer am Probentisch oder sind nur scheinbar aufgestanden und auf die Bühne gegangen, als wollten sie mir einen halbfertigen Schuh verkaufen und ich soll für die Erklärung, warum der Schuh nicht fertig ist, und für den unfertigen Schuh den vollen Preis zahlen. Auch konnte ich nicht herausfinden, warum ein 200 Jahre altes Narrativ, das auf der Bühne (bei der Mannheimer „Jungfrau von Orleans“) als veraltet beschrieben wurde, trotzdem diskutiert wird. In der Zwischenzeit haben ja unzählige Dichter den Griffel geschwungen, da lässt sich doch bestimmt ein passendes Narrativ finden. Auch war es mir bisher so vorgekommen, als sei Theatersingen ein anderes Singen, ein unmittelbares, unverstärktes, ungeschöntes, und wenn das Proben und Spielen mir Freude machte, habe ich für mich selbst die Unterstützung von Video, Mikrofonen und pompösen Kostümen nicht vermisst. Für derlei Utensilien haben die Kolleg:innen im Popgeschäft definitiv das bessere Budget.
Und wenn schon Diskurs, wenn schon Theoriegesänge, dann so unverschämt protzig, charmant und überbordend wie in „Like Lovers Do“. Da staunte ich, dass so viele drastische Worte in bunter Verpackung etwas wie ein heiteres Vergeben auslösen.
Auch sah ich junge Menschen, viele junge Menschen, die Figuren spielen wollten und konnten und die den Willen, von einer Person oder Figur zu erzählen, zu mir in den Zuschauerraum schmugelten – am Bühnendiskurs und den Regieambitionen vorbei. Nikolai Gemel, der im „Mann seiner Klasse“ leise ein Menschenleben wegträgt, Phillip Grimm, Jannik Hinsch und Henriette Hölzel, die im „Tartuffe“ das Dach vom Schauspiel Dresden abtragen, Annemarie Brüntjen, die 20 Minuten die Johanna von Orleans anskizziert, Vassilissa Reznikoff, die sich als Agnes in der „Jungfrau von Orleans“ in eine Figur träumt, hartnäckig, Gro Swantje Kohlhof, die bei „Like Lovers Do“ ohne eine Kamera auf der Bühne filmisch spielt, Vidina Popov, die in „Slippery Slope“ am Maxim Gorki Theater eigentlich kein Autotune auf ihrer Stimme braucht, Anna Drexler, die sich im „Neuen Leben“ Bühnenzeit ergaunert in Konkurrenz mit jener Lampe, und Johannes Hegemann, der als japanischer Hotelangestellter („Doughnuts“) in einem fremden Humor heimisch wird.
Und dann war da „humanistää!“ vom Volkstheater Wien. Ein Menschengedicht voller Schmerzwitz und Sprachtanz und ein Ensemble, dem ich in Gänze gern die Penunsen vom Kerrpreis überweisen würde. Aber es gibt ihn: den Unterschied.
Samouil Stoyanov, was für ein Klumpen Präzision und Grazie. Gleich am Anfang, da war er noch mit einer Maske verdeckt, fragte ich mich, wer tanzt da so kampfbereit Sprache. Dann folgte viel gute Ensemblearbeit und dann sein großer Monolog, und Samouil Stoyanov macht aus Ernst Jandls klugen kargen Sätzen einen nachdenklichen Kraftakt, schwitzt die Sprache und lässt mit dem Weglassen des Wortes „Dritter“ unser Blut gefrieren.
Ich dachte nur lieber Himmel, lass ihn nicht 50 sein, denn von fünf bis 50 hatte ich in diesem erstaunlichen Wesen alle möglichen Alter, Geschlechter und Figuren umhergehen gesehen. Nach dem Schlussapplaus also schnell auf die Straße und googeln, Samouil Stoyanov 32.
Bingo, der Kerrpreis 2022 geht an Samouil Stoyanov!
Vielen Dank!
Jurorin ist in diesem Jahr die Schauspielerin und Sängerin Valery Tscheplanowa

Valery Tscheplanowa (* 1980 in Kasan, Sowjetunion)
wuchs bei ihren Eltern im sowjetischen Kasan und bei ihrer Urgroßmutter auf dem Land auf.
Im Alter von acht Jahren zog sie mit ihrer Mutter nach Deutschland.
Tscheplanowa begann ihre Ausbildung an der Palucca Schule Dresden als Tänzerin.
Ab 1999 studierte sie Puppenspiel an der Berliner Hochschule Ernst Busch und wechselte dort nach drei Semestern ins Schauspielfach. Diesen Studiengang schloss sie 2005 ab.
Von 2006 bis 2009 war Tscheplanowa festes Ensemble-Mitglied des Deutschen Theaters Berlin und spielte dort unter anderem in Inszenierungen von Dimiter Gotscheff und Jürgen Gosch. 2009 wechselte sie ans Schauspiel Frankfurt, 2013 ans Residenztheater München. Seit 2017 und ihrem Engagement als Gretchen in Frank Castorfs Faust-Inszenierung an der Volksbühne Berlin, ist sie freischaffend – mit Schwerpunkt Film und Salzburger Festspiele.
Rückblickend meint Tscheplanowa, es sei die Liebe zur Sprache gewesen, die sie zum Theater geführt habe; die Schauspielkunst selbst gebe ihr die Möglichkeit, die Sprache noch lebendiger werden zu lassen. Ihrer Ausbildung im Puppenspiel misst sie heute einen hohen Stellenwert bei; so, wie sie gelernt habe, eine Puppe zu führen, baue sie als Schauspielerin auch die Figuren auf, die sie auf der Bühne verkörpere. Das helfe ihr nicht zuletzt bei der Darstellung von Männerrollen, die sie von Anfang an anvisierte (mit Büchners Leonce hatte sie am Deutschen Theater vorgesprochen) und die sie später auch bekam (unter anderem Tasso und Franz Mohr). Die Chance, eine Inszenierung über eine lange Zeit spielen zu können – Heiner Müllers Hamletmaschine unter der Regie von Dimiter Gotscheff beispielsweise lief sieben Jahre – schätzt sie als besonderes Privileg ihres Berufsstands; „die Erfahrungen, die die Darsteller zwischenzeitlich machten, könnten dazu führen, dass jede weitere Vorstellung zu einer echten Neubegegnung werde und sich dadurch von der vorherigen stark unterscheide.“
Befragt, welche Art von Regisseur sie bevorzuge, meint Tscheplanowa: „Jemand mit einer starken eigenen Handschrift und der Fähigkeit, diese auch dem Schauspieler zuzugestehen.“
Anlässlich des Theatertreffens 2014 erhielt sie den Alfred-Kerr-Darstellerpreis für ihre Darstellung der Njurka in Gotscheffs Inszenierung Zement. Jurorin war in diesem Jahr Edith Clever: „Naiv und kämpferisch, immer klar und leuchtend. Das war Valery Tscheplanowa, und ich war sehr froh. Und ihre klare leuchtende Stirn, ihr fester und doch leichter Schritt, ihr Singen, ihr Temperament, ihr Humor – das alles hat mich bezaubert.“
Nach Fabian Hinrichs hat die Alfred-Kerr-Stiftung mit Valery Tscheplanowa zum zweiten Mal eine frühere Preisträgerin gebeten, Jurorin zu sein. Neben dem Kerr-Preis erhielt die Künstlerin diverse Auszeichnungen, u.a. den FAUST-Theaterpreis, den Bayerischen Kunstförderpreis, den Kunstpreis der Akademie der Künste Berlin, den Ulrich-Wildgruber-Preis.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte der Preis 2021 nicht verliehen werden.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte der Preis 2020 nicht verliehen werden.
Die Preisverleihung fand am 19. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2019 ist:

Er erhält den Preis für seine darstellerische Leistung in „Das große Heft“ (Regie: Ulrich Rasche) am Staatsschauspiel Dresden.
Johannes Nussbaum (* 31. Mai 1995 in Mödling, Niederösterreich)
Nussbaum spielte bereits in der Volksschule Mödling im Schultheater mit.
Im Alter von neun Jahren gab er, an der Seite von Maria Hofstätter und Petra Morzé, sein Filmdebüt in dem 2005/2006 gedrehten und im Mai 2007 fertiggestellten Kinofilm Import Export (2007) von Ulrich Seidl. Auf Anregung der Betreuerin der Theater-AG hatte sich Nussbaum bei der Wiener Agentur Eva Roth Casting beworben, einer bekannten Agentur für die Besetzung von Kindern und Laiendarstellern. Er absolvierte erfolgreich ein Vorsprechen und Vorspielen für den Film und wurde unter mehreren Hundert Kindern für seine erste Filmrolle ausgewählt.
2008 hatte er eine Episodenrolle in der ORF-Krimiserie SOKO Donau. Er verkörperte, an der Seite von Sona MacDonald, den jüngeren Sohn einer alleinerziehenden Mutter und Bruder eines ermordeten Schülers. In dem Kinofilm Blutsbrüder teilen alles (2012), der Geschichte über die Freundschaft zweier Jungen während des Zweiten Weltkriegs, hatte er die Hauptrolle des Ferry; sein Freund und „Blutsbruder“ Alex war Lorenz Willkomm. 2012 spielte er, unter der Regie von Peter Kern, der durch Blutsbrüder teilen alles auf Nussbaum aufmerksam geworden war, die Hauptrolle in Kerns Kinofilm Diamantenfieber oder Kauf dir einen bunten Luftballon. Er verkörperte im Film den 15-jährigen Dieb Hansi, der nach dem Tod seiner Eltern ganz auf sich allein gestellt ist und für sich, seine vier Brüder und seine Großmutter sorgen muss. Für seine Darstellung erhielt er beim österreichischen Filmfestival Diagonale die Auszeichnung als „Bester Schauspieler“. Die Laudatio hielt Konstanze Breitebner. Die Jury hob insbesondere die „bemerkenswerte Leichtigkeit und authentische Präsenz“ seiner Darstellung hervor.
2013 legte er u. a. in den Fächern Deutsch, Englisch und Sportkunde die Matura ab. Seit Herbst 2014 studiert er Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Während seines Studiums trat er am Deutschen Theater Berlin in Marat/Sade (Premiere: Spielzeit 2016/17) in der Regie von Stefan Pucher auf. In der Spielzeit 2017/18 gastierte er am Staatsschauspiel Dresden in Das große Heft in der Regie von Ulrich Rasche. Im April/Mai 2018 spielte er im Wiener „Bronski & Grünberg-Theater“ den Ferdinand in Kabale und Liebe.
Für seine Rolle als Pauli in dem Fernsehfilm Die Hebamme erhielt er eine Nominierung für den New Faces Award. In dem Wiener Tatort-Krimi Deckname Kidon (Erstausstrahlung Jänner 2015) hatte er eine kleine Rolle als Lagerarbeiter Max. Im März 2015 war er in der Fernsehserie Schuld nach Ferdinand von Schirach in einer Episodenhauptrolle zu sehen. Er spielte den 17-jährigen Internatsschüler Ben und einzigen Freund und Vertrauten des Außenseiters Henry.
In der österreichischen Fernsehserie Vorstadtweiber (2015) spielte er in den bisher drei Staffeln die Rolle des Simon Schneider. Er verkörperte den – bei Beginn 16-jährigen – Sohn der Serienfiguren Maria und Georg Schneider. Er war außerdem der jugendliche Liebhaber und „Toyboy“ der 42-jährigen Serienfigur Waltraud Steinberg (Maria Köstlinger), der sich von ihr lieber in die Kunst der Liebe einweihen lässt, anstatt mit ihr Latein zu lernen. Nussbaum hatte mit seiner Rolle großen Erfolg beim Fernsehpublikum; seine Rolle wurde in Österreich groß beachtet. Er wurde u. a. als „Frauenliebling“, „Frauenschwarm“, „öffentlich-rechtliches Schnuckelchen“ und „Shootingstar aus Mödling“ bezeichnet.
In der deutschen Filmkomödie Fack ju Göhte 2 spielte er Cedric, den Anführer der Tsunamiwaisen. In dem deutsch-österreichischen Spielfilm Die Trapp Familie – Ein Leben für die Musik (2015) war er Sigi, der Jugendfreund der weiblichen Hauptfigur Agathe von Trapp.
Zu seinen Lieblingsautoren gehören Friedrich Dürrenmatt und Hunter S. Thompson. Privat hört er gerne Musik von Iron And Wine, The Tallest Man on Earth und John Butler. Nussbaum lebt in Wien und Berlin.
Ich heiße Franz Rogowski, bin Schauspieler, der eine oder andere kennt mich schon, vielleicht von der Schaubühne oder vom Film , ich war die letzten zwei Jahre an den Kammerspielen in München. Ich bin einer der Lieblingsschauspieler von Dössel , das ist eine Intellektuelle aus Bayern , die schreibt sehr viel über Theater. Ich habe ganz verschiedene Arten von Theater gemacht, von der Straßenperformance mit Saxophon bis hin zum fast klassischen Theater. Ganz klassisch ist es nie geworden, deswegen eigene ich mich auch so gut, diesen zeitgenössischen Preis hier zu vergeben.
,Im Theater ist nichts authentischer als so tun als ob“. Diese Gleichung ist bestechend und hat uns großes Theater beschert in den letzten Jahren. Es gab auch dieses Jahr viele starke Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne zu bewundern. Ich finde, wir können stolz darauf sein, noch so viele subventionierte Theater mit eigenen Ensembles zu haben.
Es wundert mich dabei nur ein bisschen, dass kein Raum auf der Bühne zu existieren scheint für ein ,,Nicht-Funktionieren“, für ein Scheitern. Anscheinend ist der Druck trotz der Subventionen ziemlich hoch. Ich meine damit keine Pantomime oder So-tun-als-ob, sondern einen richtigen Riss in der Oberfläche. Sozusagen ein totales Scheitern als subventionierte Kulturmaßname. Das ist doch eine unserer größten Qualitäten als Menschen, aber anscheinend möchte das im Moment niemand sehen. Vielleicht gibt es ja auch keinen Raum zum Scheitern.
Ich finde Scheitern so toll, weil man dann sich selbst verliert, dieses Konstrukt, dass man da vor sich herträgt davon, wie man jetzt so ist. Das kracht dann kurz zusammen, und es zeigt sich eine andere Gestalt, die da schlummert unter deiner Oberfläche.
Ich nenne ihn Mister X
Etwas anderes, das ich noch im Namen von Alfred Kerr kritisieren will, sind die stummen Räume, in denen dieses Theater stattgefunden hat . Die Bühne und die Mittel des Theaters sind zwar oft laut und technisch auf dem neusten Stand, scheinen aber fast ausschließlich dazu da zu sein, Szenenbilder, Symbole, Texttafeln, Vorhänge, Beamerleinwände, Scheinwerfer und so weiter hin und herzuschieben . Die Bühne dient dem Menschendrama wie ein Tablett dem Süppchen.
In mir ist eine große Sehnsucht gewesen nach Räumen, die eine eigene Würde haben. Räume mit einer eigenen Dimension von Zeit. Räume, die sich verändern können, wenn sie betreten werden, weil sie nicht von Anfang an betreten sind. Räume, die auch existieren, wenn das Menschendrama sie verlässt. Wenn die Theatermaschinerie dazu da ist, Menschen zu spiegeln und zu erweitern, dann ist der Kontext des Menschen auf der Bühne er selbst. Ein Mensch im Kontext von sich selbst. Stellt man sich mal vor, dass wir vielleicht alle ein bisschen egozentristisch sind und dass der Mittelpunkt von etwas überhaupt keinen inneren Raum hat, dann müssten wir uns doch ins Verhältnis setzen zu etwas anderem, um denken zu können. Wir müssten Räume schaffen zwischen uns und einem Etwas, wir müssten einen dreidimensionalen Kontext schaffen, in dem wir überhaupt stattfinden können.
Das Unglaubliche bei dem Schauspieler, den ich auszeichnen darf, ist, dass er die kalte Dusche des Scheitern gar nicht zu brauchen scheint, um seinen Mantel abzulegen. Er kommt schon halbnackt auf die Bühne. Er ist von Anfang an halbnackt, aber das ist nicht der Grund, warum er diesen Preis bekommt. Sein Herz liegt offen, ohne dass er daraus eine Show macht. Die schlummernde Gestalt der Welt hinter Figur und Bühnendekor, die war bei diesem Schauspieler immer anwesend.
Ich nenne ihn jetzt mal Mister X. Mister X hat schon als Neunjähriger in Mödling Theater gemacht. Direkt im Anschluss an sein Theaterdebüt wurde er für Film und Fernsehen entdeckt, hat auch schon Preise bekommen, ist hoch eingestiegen mit „Import/ Export“ von Ulrich Seidl. Danach kamen verschiedene Rollen im Film und Fernsehen, eine Matura in Deutsch, English und Sportkunde, ein Schauspielstudium in Berlin an der Hoch schule ErnstBusch (während dessen er ungefähr acht Filme gedreht hat, wie macht man das?).
Die Farben des Regenbogens
Jetzt spielt Mister X in Ulrich Rasches Dresdner Inszenierung von ,,Das große Heft”, nach einem Roman von Agota Kristof. Getragen von archaischen Bässen, permanent ins Publikum starrend, verausgaben sich 16 junge Zwillinge auf ihrem maskulinen Marsch. Wer Rasches letzte Arbeiten kennt, kann sich vielleicht ein Bild machen. Mister X hat es geschafft, innerhalb all dieser Dämpfe von Testosteron und Form eine Transparenz zu behalten. Und mit Transparenz meine ich nicht, dass er nicht männlich wäre oder wild oder kraftvoll. Im Gegenteil, er ist halt nicht wie ein Pavian an der Rampe gestanden, sondern eher wie eine Raubkatze mit einem Thermometer in der Hand.
Mutig entließ sich Mister X ins Ungewisse, um die Temperatur zu messen. Und seine Brüder wurden nicht zu Statisten, wenn er anfing zu sprechen. Es hat fast so gewirkt, als würde er sprechen und gleichzeitig gesprochen. Als würde er seinen Marsch unendlich fortsetzen können. Und auf einmal gab es keine Drehbühne mehr, und er hat die Welt in Gang gesetzt mit seinen Schritten.
Johannes, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, vielleicht warst du einfach müde und deswegen so gut, oder du hattest keinen Bock. Du bist toll, du hast alle Farben, die der Regenbogen hat, und versuchst nicht der Regenbogen zu sein. Du bist wirklich eine Bereicherung für das Theater und den Film.
Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du nicht verblödest, dass du dich nicht korrumpieren lässt, dass du die Menschen, die mit dir arbeiten wollen, aber auch von dir profitieren, nur so weit in dich reinlässt, dass du intakt bleiben kannst.
Ich freue mich auf alles, was da kommt mit dir und von dir. Ich danke dir, dass du ein Teil bist vom diesjährigen Theatertreffen. Du hast eine unglaubliche Präsenz auf der Bühne, ohne dich in den Vordergrund spielen zu müssen. Du bist virtuos und gleichzeitig berührbar. Du bist echt der Oberhammer. Der Alfred Kerr Preis 2019 geht an Johannes Nussbaum.
Franz Rogowski, Berlin, 19. Mai 2019
Juror war in diesem Jahr der Theater- und Filmschauspieler Franz Rogowski.

Franz Rogowski (* 2. Februar 1986 in Freiburg im Breisgau)
Der Sohn eines Kinderarztes und einer Hebamme wuchs in einem bürgerlichen Umfeld in Tübingen auf. Mütterlicherseits ist Franz Rogowski Enkel des früheren BDI-Präsidenten Michael Rogowski. Er erhielt eine Tanzausbildung, nachdem er zuerst Fahrradkurier werden wollte. Seit 2007 ist er in der freien Theaterszene aktiv. Er trat an diversen Bühnen, darunter das Thalia Theater Hamburg, das Schauspielhaus Hannover oder die Schaubühne am Lehniner Platz, als Tänzer wie auch als Choreograf oder Schauspieler in Erscheinung.
Rogowski hat von Geburt an eine Lippenspalte, die operativ geschlossen wurde, und lispelt daher beim Sprechen. Er wurde vom Berliner Regisseur Jakob Lass als Kinoschauspieler entdeckt. Lass setzte ihn 2011 in Frontalwatte und zwei Jahre später im preisgekrönten Love Steaks (2013) jeweils für die männliche Hauptrolle ein. 2015 folgte die Mitwirkung am Berlinale-Wettbewerbsbeitrag Victoria unter der Regie von Sebastian Schipper. Mit der Spielzeit 2015/16 wurde der schauspielerische Autodidakt, der nie eine Schauspielschule besuchte oder -lehrer engagierte, festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele.
2017 war Rogowski als Sohn von Isabelle Huppert in Michael Hanekes Spielfilm Happy End zu sehen, der bei den 70. Internationalen Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt wurde. 2018 folgen Hauptrollen in den Kinoproduktionen Lux – Krieger des Lichts von Daniel Wild, In den Gängen von Thomas Stuber und Transit von Christian Petzold. Die beiden letztgenannten Filme erhielten Einladungen in den Wettbewerb der 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin, wo Rogowski eine Ehrung als deutscher „Shooting Star“ zuteil wurde. Im selben Jahr gewann Rogowski den Deutschen Filmpreis als Bester Hauptdarsteller für In den Gängen.
Die Preisverleihung fand am 20. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2018 ist:

Er erhält den Preis für seine Interpretation der vielen Rollen, die er in Elfriede Jelineks „Am Königsweg“ am Schauspielhaus Hamburg spielt.
Benny Claessens, 1981 in Antwerpen geboren, studierte am Herman Teirlinck Instituut für Darstellende Kunst.
Von 2006 bis 2010 wirkte er als freischaffender Künstler für das Kunstzentrum Campo in Gent und das Theaterkollektiv Dood Paard in Amsterdam. Für seine Rolle in Thomas Bern- hards „Ritter, Dene, Voss“ erhielt er 2009 den VSCD Arlecchino Award in Amsterdam.
Von 2010 bis 2015 war er bei den Münchner Kammerspielen engagiert und arbeitete u.a. mit René Pollesch und Johan Simons zusammen. Außerdem konzipierte er während dieser Zeit die Produktion
„Spectacular Lightshows“, in der er selbst als Darsteller mitwirkte, und realisierte mit Jan Decorte „Much Dance“. Im selben Jahr entstand seine Performance „Hello useless“ für Campo und 2016 „Learning how to walk“ am NTGent.
2017 begann seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Ersan Mondtag in Ödipus und Antigone nach Sophokles am Maxim-Gorki-Theater Berlin.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Bevor wir zur Freude des Gebens und der Tugend des Annehmenkönnens gelangen und vielleicht auch dorthin, wo es wehtut, möchte ich mich bei der Alfred Kerr-Stiftung, bei Thorsten Maß und bei Frau Dr. Deborah Vietor-Engländer, bei Peter Böhme, bei Prof. Dr. Peter von Becker, bei Herrn Dr. Günther Rühle und bei Dr. Thomas (Oberender) für das geschenkte Vertrauen bedanken, den diesjährigen Träger des Alfred Kerr-Darstellerpreises auswählen zu dürfen.
Bist du Künstler oder Service?
Bei einer auch von mir dann und wann besuchten Rhetorikvorlesung offenbarte der diensthabende Professor uns, den Studierenden, der erfolgreichste und kürzeste Weg, sich beim Halten einer Rede, einer Laudatio, die Gunst und das Wohlwollen der Zuhörenden zu sichern sei es, folgendermaßen zu beginnen: “Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluß.” Ich möchte diesen Schluss aber nun doch noch ein ganz klein wenig ausdehnen.
Warum sollte jemand Schauspieler sein, sein wollen, wenn er nicht die Kunst anderer Schauspieler würdigen kann? Warum sollte jemand Maler sein, wenn er nicht die Kunst anderer Maler würdigen kann? Sie merken schon, die Reizwörter Kunst und Schauspieler werden tatsächlich in einem Atemzug genannt und dann sozusagen zusammen in ein Separée gesperrt, damit sie sich paaren und hoffentlich auch vermehren können- etwas mehr also als bloß eine sanfte Andeutung der richtigen Antwort auf die wichtigste Frage für Schauspieler im 21. Jahrhundert: Bist Du Künstler oder arbeitest Du im Service?
Es gibt in der nearktischen und paläarktischen Region, also grob gesagt Nordamerika, Grönland undsoweiter und die Nordhalbkugel, einen Fisch namens Stenodus leucichthys, den Weißlachs, einen Speisefisch, mit festem, öligen, schmackhaften Fleisch. Der Weißlachs hat einen schön-rätselhaften Trivialnamen- er heisst auch “I’inconnu “der Unbekannte” – die Amerikaner machen daraus natürlich etwas anderes, sie nennen ihn einfach “Conny”. Als den Europäern dieser Fisch aus Sibirien und Nordamerika bekannt wurde, erweckten die Schilderungen der Reisenden den Eindruck unerschöpflicher Schwärme. Mittlerweile weiß man, dass Riesenschwärme großer Fische in der Arktis wegen temperaturbedingt geringer Produktivität besonders leicht überfischbar sind. Aber noch einschneidender auf die Größe der Weißlachs-Populationen und auf seine allgemeinen Lebensbedingungen wirkten spätere Maßnahmen wie Fluss-Regulierungen, Dämme, Sperren, Begradigungen, Wasserkraftwerke.
Connys Fortbestand ist stark infrage gestellt worden, die Lage wird noch weiter durch die Weigerung von Conny dem Inconnu verschärft, “Aufstiegshilfen” in den Flüssen anzunehmen. Sie ahnen vielleicht, worauf ich hinauswill: es liegt auf der Hand, der Inconnu aus der Arktis, dieses in seinem Da-Sein bedrohte Tier ist das fischige spiegelblidliche Gegenüber, der Sosias des deutschen Schauspielers im 21. Jahrhundert. Hier Conny, der Weißlachs, dezimiert und zurückgehalten durch den Kampf mit Sperren, mit Regulierungen, Mauern, eine gefährdete schmackhafte anmutige wilde Tierart von eigener Schönheit, und dort sein humanoider Verwandter, der Schauspieler als Künstler, ungefähr seit Beginn der Renaissance in einzelnen Exemplaren ausgestattet mit einer ganzen Welt in einem Kopf und in einem Körper, gesellschaftlich zwar geächtet als liederlich, nach seinem Tod verscharrt an Uferböschungen, dessen Lebensräume aber der Himmel und das Darüberhinaus, das nach oben Gespannte waren.
Der künstlerische Schaupieler ist nun heute aber ebenfalls inconnu, ruhmlos, ein Träger von Talenten ohne Heimat, gefangen in den Rückhaltebecken der Regie-Konzepte, in den begradigten Wahrheiten der flachen Ästhetiken, in trostlosen Betonbecken moralischer Selbsgewissheit. Eine gefährdete Spezies, dessen besondere Gefährdung aber auch weitgehend inconnu sein dürfte, unbekannt. Gäbe es so etwas wie den Europäischen Gerichtshof für Theaterrechte, könnten nahezu alle Inszenierungen des diesjährigen Theatertreffens als Beweismittel für die Wahrhaftigkeit derjenigen Zeugenaussage Egon Friedells dienen, die er Anfang des letzten Jahrhunderts zu Protokoll gab: Theater und Militär, dem Anschein nach höchstens durch eine Konträrfaszination miteinander verbunden, sind in Wahrheit Verwandte, Brüder im Geiste, geworden.
Der deutsche Schauspieler des beginnenden 21. Jahrhunderts könnte berichten: so kam ich unter die Theaterregisseure. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen – ist das nicht, wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergoßne Lebensblut im Sande zerrinnt? Ich muß schon sagen, es war ziemlich anstrengend, einen jungen Alfred Kerr-Preis-würdigen Schauspieler aufzuspüren, einen jungen Künstler, einen souveränen Schauspieler, keinen Dar-Steller und Dar-Geher und Dar-Steher, einen, den auch Alfred Kerr selbst vielleicht als Persönlichkeit ausgemacht hätte, keinen, der mit den Fingern schnipst, weil ihm gesagt wurde, er solle jetzt mal schnipsen.
Es war anstrengend!
Und sie waren bestimmt auch da in diesem Jahr, auf der Bühne, bestimmt, ich hoffe es, aber sie waren nicht zu sehen, unsichtbar, inconnu, denn es herrscht anscheinend weitgehend ein stillschweigendes Auftrittsverbot für den künstlerischen Schauspieler (bis auf wenige kräftige mutmachende leitbildhafte Ausnahmen, die allerdings alle schon etwas betagter und somit zwar voller Zukunft sind, aber nicht für diesen Preis infrage kommen: Sophie Rois, Joachim Meyerhoff, Martin Wuttke zum Beispiel) und was Anderes bleibt dem heutigen deutschen Schauspieler zunächst (!) übrig, als sich zu fügen und sich die Uniform anzuziehen, die man ihm in den Spind gehängt hat, wenn er weiter in Lohn und Brot stehen muß.
Es war anstrengend und diese Anstrengungserfahrung kann eigentlich nicht überraschen, denn es sind anstrengende Zeiten, auch am und im Theater, nicht zuletzt für Angehörige dieser alten selektionserfahrenen und dennoch stark gefährdeten Spezies der schauspielenden Künstler, der Schauspieler also. Und ich befürchte auch anstrengende Zeiten für ein Publikum? “Ein jeder treibt das Seine, wirst du sagen, und ich sag es auch. Nur muß er es mit ganzer Seele treiben, muß nicht jede Kraft in sich ersticken, wenn sie nicht gerade sich zu seinem Titel paßt, nur sein, mit Ernst, mit Liebe muß er das sein, was er ist, so lebt ein Geist in seinem Tun, und ist er in ein Fach gedrückt, wo gar der Geist nicht leben darf, so stoß ers mit Verachtung weg und lerne pflügen!” Sagte Friedrich Hölderlin Ende des 18. Jahrhunderts. Die deutschen Bühnendarsteller und Regisseure im Jahre 2018 aber bleiben beim Notwendigsten, und darum ist bei ihnen wenig Freies, Echterfreuliches. So wenig Freies. So wenig Echterfreuliches.
Auf meiner Suche nach dem souveränen Schauspieler mit einer Leitung nach oben begegnete mir preussischer Gehorsam, wohl als erschütterndes, durch die Generationen hindurch gewandertes Erbe des preußischen Militarismus, wackeres Soldatentum, man sah Menschen bei anstrengender Arbeit zu. Denn obwohl sich die Regisseure für die Übermittlung ihrer jeweiligen gut gemeinten Moralnachrichten eine teure abendliche Eskortbegleitung in Gestalt von massivem Einsatz von Ton und Gewerken, von Technik, von Kopfhörern, Verstärkern, riesigen Rädern, Visuals, Pauken, Zaubertricks und vokalem Extremsport engagierten, verschwimmt in der Rückschau das Meiste doch zu einer seltsam gleichförmigen Masse, den gleichaussehenden Autos auf unseren Strassen ähnlich.
Und wo war der Schauspieler hin? Wo ist er hin? Gibt es ihn noch? Um nur zwei von unzähligen Beispielen zu nennen: auf dem Theatertreffen vor zwei Jahren wird eine Podiumsdiskussion unter dem Titel abgehalten “Wovon wir sprechen, wenn wir vom Schauspielen sprechen” und es ist nicht ein einziger Schauspieler auf diesem Podium anzutreffen, sondern ausschliesslich irgendwelche anderen Leute. Inconnu! Und niemandem fällt es auf, niemand sagt etwas, niemand stößt sich daran. Man kann natürlich wie bei Markus Lanz eine Diskussion über “Wovon sprechen wir wenn wir über Klavierspielen sprechen” machen und dann Boris Becker und Frank Walter Steinmeier einladen, aber sollte das Theatertreffen wirklich wie Markus Lanz sein? Zweites Beispiel: in diesem Jahr gab es eine Diskussion über Ästhetik im zeitgenössischen Theater und nicht ein einziger … ich muss den Satz nicht zu Ende schreiben, zu Ende sprechen.
Was ist da los? So sollte man nicht mit der ältesten Theaterkunst, der Kunst des Schauspielers, umgehen. Und so sollte man als künstlerischer Schauspieler nicht mit sich umgehen lassen, als wäre man ein Soldat, der in der Kaserne einsatzbereit auf Befehle zu warten hat, während die selbsternannten und so oft überforderten Offiziere im Kasino Pläuschchen halten. Dieses Identifikationsangebot sollte man ablehnen, wenn man Schauspieler ist. Die Tatsache, dass Schauspieler auch große Intendanten waren, und zwar während sie noch spielten (Kortner, Reinhardt, Weigel, Gründgens), wirkt heute wie eine wie eine Erinnerung, die nicht stimmen kann. Goethe, Moliére und Shakespeare waren Schauspieler. Aber eben nicht nur. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich nicht falsch, es ist ja klar: wer nicht mitmacht, wird entlassen. Und dann wohl lieber ein künstlerisches Auftrittsverbot als gar nicht mehr aufzutreten, denn neben dem Ödipuskomplex gibt es ja auch noch den existentielleren Komplex- den Geldkomplex.
Die Stimmung war also einigermassen im Keller angelangt. “Und dann” – zu meinem, zu unserem Glück – “und dann kam Benny” (vielleicht sogar ein ganz pfiffiger Titel). Benny Claessens. “Mit Ernst, mit Liebe muß er das sein, was er ist, so lebt ein Geist in seinem Tun”. Benny Claessens kam, er sprach, er sang, er tanzte, er war einfach da (in Am Königsweg, Schauspielhaus Hamburg, Text Elfriede Jelinek, Regie Falk Richter). Inmitten all des entfremdeten, austauschbaren und nicht zuende sozialisierten, notgedrungen oder sogar freudig mitlaufenden Servicepersonals auf den Bühnen dieses Theatertreffens gab es jemanden mit Präsenz. Präsenz als erfahrbarer Unterschied zur Entfremdung.
Der Begriff “Präsenz” kommt vom lateinischen prae-esse und prae-esse meint “Berührbarkeit”. Benny Claessens ist in einem geradezu bedrohlichen Grade berührbar. Man schaut ihn an und da drängt er sich wieder auf, der zwischendurch verlegte, diskriminierte Gedanke, dass ein Schauspieler ein ganzes Theater sein kann. Trotz allem. Trotz allem! Trotz des Korsetts einer Nummernrevue, trotz der bunten Sachen auf den Körpern und neben den Körpern der Schauspieler, die nur umso deutlicher den eigentlich mausgrauen Stein unter dem bunten Farbanstrich zutage treten lassen. Inmitten dieser als bunte Travestieshow getarnten preussischen Kaserne war da eine eigene Stimme, ein eigener Körper, eigene Gefühle. Ja Leute, Gefühle, Soul. Und, schnallen Sie sich an: Denken, eigenes Denken.
Auch wenn es anscheinend verboten ist, verrate ich es Ihnen heute: ein Schauspieler wie Benny Claessens kann fühlen UND denken. Gleichzeitig! Und sich bewegen und sprechen und er kann sogar wild sein! Benny Claessens kann tatsächlich wild sein, chaotisch, irrational. Er kann wirklich so sein, wie all die Kulturwissenschaftler in ihren Proseminaren, die jetzt den Theaterbetrieb kapern, im Büro nicht sein können: wild, zart, ernst, liebevoll, geistvoll. Er kann Gefühlsgedanken haben, man kann mit ihm träumen. Und er kann richtig gut singen. Er kann so singen, dass ich (fast) weinen muss. Ist das falsch? Im Theater zu weinen? Nein, natürlich nicht, wie krank wäre die Verneinung dieser Frage. Warum wäre es falsch, im Theater zu weinen, wenn Benny Claessens singt? Und – ganz ganz wichtig – er langweilt nicht. Man schaut ihm zu, man ist MIT ihm und ein unbewusster Dialog, den er zuläßt, den er anstößt, beginnt und dann – langweilt er einfach nicht. Denn das wissen wir: denen, die langweilen, kann man nur schwer verzeihen.
Wenn Benny Claessens die Bühne verlässt, ist man traurig, es hätte ruhig noch viel länger weitergehen können, ganz ohne Frösche und Mikroport. Und er ist widersprüchlich, Benny Claessens, er ist sozusagen nicht bruchfest. Denn ist es nicht so, dass nur bei den flachen Wahrheiten das Gegenteil falsch ist und bei den tiefen Wahrheiten auch das Gegenteil wahr? Benny Claessens ist nicht so furchtbar selbstgewiss, wie es die Inszenierung (und vermutlich auch der Text) selbst war, in der er auftrat, wie es (fast) alle Inszenierungen waren, die ich sehen durfte, er widersteht den Vereinfachungen durch sein Da-Sein, im Theaterraum.
Was ist denn Theater, was kann denn Theater für uns sein? Theater kann ein kultischer Raum sein, ein Raum, in dem für einen Moment die existentielle Einsamkeit jedes Einzelnen in diesem darwinistischen Gesamtalptraum kollektiv spürbar wird, in dem Brücken geschlagen werden, in diesem Raum, für diesen Moment, lauter kleine zerbrechliche Brücken zwischen all diesen Individuierten, in ihrer eigenen existentiellen Notsituation Versammelten und für diesen kurzen Moment kann die Ahnung von Gemeinschaft, von einem gemeinsamen Träumen von Individuen enstehen, die alle in unterschiedlicher Art und Weise Schmerz empfinden, die alle in unterschiedlicher Art und Weise in Reibung zum gesellschaftlichen Kollektiv stehen. Der Schauspieler aber könnte in diesem Sinne dann ein Lebensmedium sein, für alle, die noch nicht erloschen sind und deren Blick nicht Benny Claessens Präsenz verpasst.
Diese erloschenen Leute, denen Benny Claessens vielleicht oft in München an den Kammerspielen begegnet oder eben nicht begegnet ist, sind die, die Friedrich Hebbel im Blick hatte als er sagte: es gibt Menschen, die stehen vor dem Meer und sehen nur die Schiffe die darauf fahren und auf den Schiffen nur die Waren die sie geladen haben. Dieser Blick wirft alles heraus, was keinen Materialcharakter hat und dieser Blick verhindert auch den Dialog. Dabei, so habe ich es EMPFUNDEN, ist doch Benny Claessens dieser Dialog so existentiell wichtig, Benny Claessens kreist nicht um sich selbst, wie das Theater gerade um sich selbst kreist im Moment.
Eine große Verwirrung in den Geisteswissenschaften seit ihrer Entstehung im frühen 19. Jahrhundert liegt in der Annahme, dass weil unsere Instrumentarien die Begriffe, also cartesianische Instrumente sind, müssen auch die Objekte ausschließlich cartesianische sein. Alles, was Gegenstand der Geisteswissenschaften sein könnte, und eben also auch Gegenstand der Theaterkritik, wird durch die Konzentration auf Sinnzuschreibungen, auf Interpretierbares ausgeschlossen, alle ästhetische Erfahrungen, die nicht im Lesen bestehen. Der ästhetischen Erfahrung der Stimme, des Körpers, der eigenen Schönheit von Schauspielern kommen wir mit Sinnzuschreibungen nicht nahe.
Ich könnte jetzt sagen, da wäre bei Benny Claessens etwas Zerbrechliches, Weiches, Berührbares, Grobes, Wildes, Feines, das mag alles sein, das mag alles stimmen oder auch nicht, das ist nicht wichtig, denn darum geht es nicht. Denn es ist eben etwas spürbar, dass zutiefst künstlerisch ist- künstlerisch in dem Sinne, das es das Zweckmässige ohne Zweck ist, etwas, das sich unserer Definition entziehen möchte und auch entzieht. Wenn man Benny Claessens auf der Bühne erfährt, drängt sich vielleicht am ehesten und am verbindlichsten ein Begriff auf, den die Deutsche Gesellschaft für Theaterpathologie, wenn es sie gäbe, erst noch exhumieren musste, damit er überhaupt in dieser Rede auftauchen könnte: Poesie. Denn nicht die möglichst realistische Abbildung von Krisen ist primär politisch, sondern die Poesie ist es.
Nichts scheint momentan politischer zu sein als Poesie. Sie ist da, dann wieder nicht. Sie befreit uns zur Spontaneität, Benny Claessens ist spontan! Und er hat sich den Raum dafür genommen, so wie es eben ging, ob gegen Widerstände, das weiß ich nicht, denn Schauspieler sind strukturell betrachtet nicht die Entscheider. Sollte es sich dann letzten Endes also gar nicht um eine Krise des Theaters, des künstlerischen Schauspielers handeln? Denn was ist eine Krise? Eine Krise ist eine Entscheidung ohne Entscheider. Aber es gibt sie ja, die Entscheider. Sie treffen nur leider anscheinend, im buchstäblichen Sinne an-scheinend, die falschen Entscheidungen, warum auch immer. Poesie aber, hilft uns Max Frisch in seiner eher unbekannten Poetikvorlesung “Das schwarze Quadrat” ist zweckfrei, sie unterwandert ideologisiertes Bewusstsein, das macht sie subversiv. Sie ist unbrauchbar und arrogant.
Eine Theateraufführung, ein Schauspieler muss uns nämlich nicht die Staatsverschuldung oder das Problem eines Endlagers für Atommüll erklären oder die Präsidentschaft Trumps mit Fröschen und Fernsehkommentatoren illustrieren. Denn das sind nur Angebote, sofort damit einverstanden zu sein. Was beschreibt Rilke, wenn er eine Skulptur von Rodin betrachtet: “Keine Stelle, die Dich nicht sieht”? Eine ästhetische Erfahrung, die den Betrachter, die Betrachterin so trifft, hat eine Wahrheit, die ich anders nicht erfahren kann. Und damit wir an der Wahrheit der Welt nicht zugrunde gehen, dafür brauchen wir die Kunst. Als Widerspruch zur Welt, als Beantwortung meiner eigenen Mangelerscheinung. Wir brauchen dafür künstlerische Schauspieler wie Benny Claessens, wir brauchen keine Reenactments, (meinetwegen auch Reenactments, zur Abwechslung dann aber, nicht hauptsächlich) wir brauchen keine Förmchen, wir brauchen Denkformen und Fühlformen, die wir selber nicht aufbringen können.
Ich brauche nicht die absichtsbetankte Form eines Regisseurs – denn was sagte Anthony Hopkins nochmal darüber, was ein Regisseur ihm überhaupt für einen Hinweis geben dürfe? Das müssen wir uns wieder ins Bewusstsein rücken: ein Regisseur dürfe ihm nur sagen, ob “schneller oder langsamer”. Und das ist natürlich richtig – und falsch. Denn was wir brauchen ist die Begegnung, das Gemeinsame. Wir brauchen nämlich die eigene Form, zum Beispiel von Benny Claessens, seine Ästhetik, seine ganz eigene Schönheit, denn er ist schön, sein Da-Sein, seine spürbaren Bauprinzipien seines Bewusstseins, die dann auf dann auf die Bauprinzipien von Anderen (Bühnenbildner, Autor, Kostümbildner) treffen, damit etwas Drittes entsteht.
Denn was anderes ist Existenz als Da-Sein im Raum? Und wo anders lässt sich Da-Sein so verdichtet erfahren, erleben, erspüren, als Wahrheit, die wie der Blitz grell alles erleuchtet, um einen herum, in einem und eben dadurch und nur dadurch genauso schnell die absolute Dunkelheit erfahrbar macht? In der Musik natürlich, in der Literatur, im Theater. Wenn das in der Kunst schon nicht mehr stattfindet, als Gegenwelt zur durchrationalisierten, durchfunktionalisierten Schein-Wirklichkeit, ja wo denn dann? Jedenfalls nicht in der robotischen Wirkungsmechanik.
Könnte man sich vorstellen, dass Benny Claessens durch einen Roboter ersetzt werden könnte? Nein, nein, nein.
Lieber Benny, es gibt nur eine sichere Methode, die Zukunft vorauszusagen – gib ein Versprechen ab und halte es. Du bist das Versprechen des souveränen Schauspielers, der das Theater rettet, indem er das Theater wieder zu einem Ort der GEGENWELT macht, einem Ort, den eine Spannung senkrecht nach oben kennzeichnet, der voll von Welt ist, weil er Weltfremdheit zulässt, ein Ort, der nicht wie eine Dokumentation auf Arte ist und auch keine nachgestellte Tagesschau, kein selbstgewisser Leitartikel, keine ostelbische Kaserne, kein Proseminar, keine schlechtgelaunte kritische Theorie, kein Regie-Gefängnis. Nur Gefängsniswärter haben etwas gegen Eskapismus. Die Welt ist voll von Gefängniswärtern, denn die Welt ist voll von Kerkern. Das Theater aber – der Schauspieler, der Bühnenbildner, der Autor – das Theater könnte ein Fenster sein in diesen Kerkern, ein vergitterte Fenster zwar, aber immerhin. Das könnte das Theater sein.
Und das Theater, das bist Du, Benny.
Fabian Hinrichs / Berlin, 20. Mai 2018
Juror war in diesem Jahr der Schauspieler Fabian Hinrichs, der 2012 selbst den Alfred-Kerr-Darstellerpreis erhielt.

Fabian Hinrichs (* 1974 in Hamburg)
Der Sohn eines Polizisten wechselte von einem Jurastudium an die Westfälische Schauspielschule Bochum. Nach dem Studienabschluss gehörte er von 2000 bis 2005 dem Ensemble der Volksbühne Berlin an. Hier trat er unter anderem in den Stücken Paul und Paula, Endstation Amerika, Forever Young und Atta, Atta auf. In der Saison 2005/2006 war er bei den Münchner Kammerspielen in einer Hauptrolle in Iphigenie auf Tauris zu sehen, in der Spielzeit 2010/2011 stand er in dem Stück XY Beat von René Pollesch dort wieder auf der Bühne.
Seinen ersten Filmauftritt hatte er in der 2003 gedrehten und 2004 uraufgeführten schwarzen surrealen Komödie Schussangst in der Hauptrolle des Lukas Eiserbeck. 2005 folgte als eine seiner bekanntesten Rollen die des Hans Scholl im Oscar-nominierten Spielfilm Sophie Scholl – Die letzten Tage und die Rolle des Alexander Halberstadt in der deutsch-belgischen Kinoproduktion Die Bluthochzeit. 2006 trat er in dem Fernsehfilm Neandertal auf. Er war in der Rolle des Daniel in dem 2007 gedrehten Drama Früher oder später unter der Regie von Ulrike von Ribbeck zu sehen.
In der Theatersaison 2007/2008 trat er in Schorsch Kameruns Projekt Biologie der Angst im Schauspielhaus Zürich auf. Im Rahmen der Wiener Festwochen 2009 spielte er in Schorsch Kameruns Bei aller Vorsicht den Profi aus Deutschland.
In Liebe und andere Gefahren, der als ZDF-Fernsehfilm der Woche am 16. März 2009 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, spielte Hinrichs einen der Polizeibeamten, Henning Linker. Ein weiterer ZDF-Film mit Fabian Hinrichs war Rainer Kaufmanns Das Beste kommt erst.
In dem Ende 2009 erschienenen Spielfilm 66/67 – Fairplay war gestern spielte Hinrichs den Fußballfan Florian, der mit seinen fünf Freunden zwischen der Liebe zu dem Fußballclub Eintracht Braunschweig, Gewalt und Freundschaft den Weg durchs Leben sucht. Für den Film Schwerkraft schlüpfte Hinrichs in die Rolle des Bankers Frederick Feinermann, der nach dem Selbstmord eines seiner Kunden auf die schiefe Bahn gerät und fortan all das auslebt, was er die Jahre zuvor unterdrückt hatte. Beim Filmfestival Max Ophüls Preis 2010 erhielt Hinrichs dafür einen nur ausnahmsweise vergebenen Sonderpreis Schauspiel.
2010 trat Hinrichs in der Berliner Volksbühne als Protagonist in René Polleschs Solostück Ich schau dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang! auf. Dafür erhielt er eine Auszeichnung als Schauspieler des Jahres in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute.
Im Oktober 2010 wurde im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg das von Studio Braun inszenierte Theaterstück Rust – Ein deutscher Messias uraufgeführt, in dem Hinrichs die Hauptrolle des Mathias Rust übernahm.Seit Januar 2012 spielt er den Ich-Erzähler im Theaterstück Kill your darlings! Streets of Berladelphia von René Pollesch, mit dem er 2012 beim Berliner Theatertreffen eingeladen war und den Alfred-Kerr-Darstellerpreis gewann.
Viel Aufmerksamkeit erhielt Ende 2012 Hinrichs’ Darstellung des nervenden Assistenten Gisbert Engelhardt im Münchner Tatort Der tiefe Schlaf. Seit April 2015 ist Hinrichs im neuen zweiten Tatort-Team des Bayerischen Rundfunks, das in Franken ermittelt, als Hauptkommissar Felix Voss zu sehen.
Fabian Hinrichs ist Mitglied der Deutschen und der Europäischen Filmakademie.
Die Preisverleihung fand am 21. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2017 ist:

Er erhält den Preis für seine Rolle des Theodor in Simon Stones „Drei Schwestern“ nach Anton Tschechow, einer Produktion des Theaters Basel.
Michael Wächter wurde 1986 in Leipzig geboren und ist Ensemblemitglied am Theater Basel, wo er in den Inszenierungen „Engel in Amerika“, „Oresteia“ und „Idomeneus“ zu sehen ist.
Er studierte an der Roosevelt High School of Performing Arts in Kalifornien und an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin.
Von 20100 bis 2015 war er Ensemblemitglied am Deutschen Nationaltheater in Weimar.
… habe ich mich für einen Kollegen entschieden, der mich in seiner geradezu rasenden Rollenentfaltung durch die Geschichte des Abends getragen hat. Er vermag seinen großen Schmerz und seine Verzweiflung ins Extreme zu jagen … seinen Lebens- und Liebesentwurf gescheitert zu sehen. Ich fürchtete um diesen Menschen Theodor, der von selbstzerstörerischer extrovertierter Aggression und unterdrückter Wut schier um den Verstand gebracht wurde. Und dann immer wieder kurze Momente des Stillstands. Das hilflose Zusehen bei einer Katastrophe … das war atemberaubend.
Imogen Kogge / Berlin, 21. Mai 2017
Jurorin war in diesem Jahr die Schauspielerin Imogen Kogge.
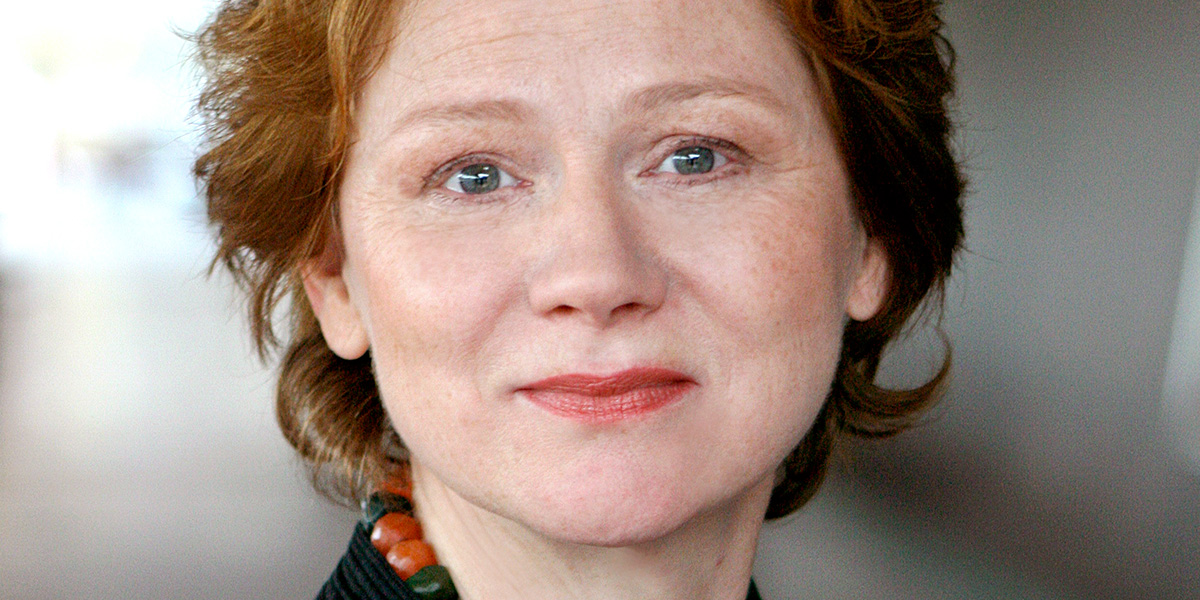
Imogen Kogge (* 1957 in Berlin)
Sie erhielt ihre Schauspielausbildung an der Hochschule der Künste in Berlin. Ihr erstes Engagement führte sie 1980 an das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg, dessen Ensemble sie bis 1984 angehörte.
Nach dem Engagement bei Claus Peymann am Schauspielhaus Bochum (1984/85) wechselte sie 1985 zu Peter Stein an die Berliner Schaubühne, wo sie u.a. mit Luc Bondy, Klaus-Michael Grüber und Andrea Breth arbeitete und mit deren Inszenierungen sie mehrfach zum Theatertreffen eingeladen wurde.
Nach ihrem Abschied von der Berliner Schaubühne im Jahr 1997 setzte Imogen Kogge ihre Karriere beim Film und Fernsehen fort. Ihre Leidenschaft für das Theater blieb weiterhin bestehen und so arbeitete sie als Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum und als Gast u.a. am Düsseldorfer Schauspielhaus sowie im Renaissance-Theater Berlin.
Imogen Kogge wurde für ihre darstellerischen Leistungen sowohl am Theater als auch in Film- und Fernsehproduktionen wiederholt ausgezeichnet, u.a. mit dem Bochumer Theaterpreis (2007), dem Deutschen Filmpreis LOLA (2006), dem Adolf Grimme Preis (2006), dem Sonderpreis der Deutschen Akademie für Darstellende Künste (1999) und dem Boy-Gobert-Preis (1982).
Sie unterrichtete am Salzburger Mozarteum, an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ und der Universität der Künste in Berlin. Seit 2002 ist sie auch als Opern-Regisseurin tätig.
Die Preisverleihung fand am 22. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2016 ist:

Er erhält den Preis für seine Rolle des Studenten Arkadij Nikolajitsch Kirsanow in Daniela Löffners Inszenierung „Väter und Söhne“ (Brian Friel nach Iwan Turgenjew) am Deutsches Theater in Berlin.
Marcel Kohler wurde 1991 in Mainz geboren.
Er absolvierte seine Schauspielausbildung von 2011 bis 2014 an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin und ist seit Februar 2015 Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin.
Er ist Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes.
2012 gewinnt er für sein Stück „Costa“ den internationalen Wettbewerb für neue Theatertexte „Lingue in Scena“ des Goethe-Instituts und der Buchmesse Turin, wurde 2013 mit dem Best Acting Prize beim 3. Internationalen Festival der Schauspielschulen in Peking ausgezeichnet und erhielt 2014 den O.E. Hasse-Preis.
…Marcel Kohler ist kein Blender, er ist einfach da, er stellt sich zur Verfügung. Sein Spiel ist gänzlich unkorrupt und dadurch: jung. Es freut mich zu sehen, wie zugewandt dieses Spiel ist und wie wichtig und wertvoll Kohler ganz offensichtlich seine Spielpartner sind.
Es gibt in der Aufführung ein Lied, das Arkadij und Katja singen, es beschreibt in seiner Energie und Unabhängigkeit aufs schönste das Wesen der Liebe. In der darauffolgenden Szene unterhalten sich die beiden. Katja fragt: Soll ich Ihnen mal ehrlich sagen, was ich glaube? Arkadij: Was denn? Katja: Sie sind noch sehr unreif. Aber das gibt sich mit der Zeit.
Ich sehe den beiden zu, und denke: hoffentlich noch nicht so bald.
Maren Eggert / Berlin, 22. Mai 2016
Jurorin war in diesem Jahr die Schauspielerin Maren Eggert.

Maren Eggert (* 1974 in Hamburg)
Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie von 1994 bis 1998 an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München.
Nach einem Gastengagement in Zürich war sie von 1998 bis 2000 im Ensemble von Leander Haußmann am Schauspielhaus Bochum. Dort entdeckte sie Ulrich Khoun und holte sie mit Beginn seiner Intendanz in Hamburg an das Thalia Theater, wo sie von 2000 bis 2009 zum Ensemble gehörte.
Während ihres Engagements in Hamburg erhielt sie nicht nur den Boy-Gobert-Preis der Körber-Stiftung (2002), sondern auch den ebenfalls nach einem berühmten Kollegen benannten Ulrich-Wildgruber-Preis (2007) und den Rolf-Mares-Preis (2007). Mit Ulrich Khuon wechselte Maren Eggert 2009 an das Deutsche Theater nach Berlin.
Neben ihrer reichen Theaterarbeitet ist sie immer wieder in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Für ihre Darstellung in „Die Frau am Ende der Strasse“ wurde Maren Eggert gemeinsam mit Matthias Brandt 2008 mit dem Deutschen Kritikerpreis ausgezeichnet. Ihre Stimme lieh sie zudem verschiedenen Hörbuchproduktionen.
Maren Eggert ist deutsche Botschafterin der UN-Dekade „Biologische Vielfalt“.

Sie erhielt den Preis für ihre Rolle der Frida Foldal in Karin Henkels Inszenierung „John Gabriel Borkman“ am Deutsches Schauspielhaus in Hamburg.

Sie erhielt den Preis für ihre Rolle der Frida Foldal in Karin Henkels Inszenierung „John Gabriel Borkman“ am Deutsches Schauspielhaus in Hamburg.
Gala Othero Winter wurde 1991 in Hessen geboren.
Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.
Vor ihrem Studium spielte sie bereits in Frankfurt am Main am Theater Willy Praml in »Hyperion. Hölderlin«, sowie in »Der zerbrochne Krug«.
An der Hochschule wirkte sie in mehreren Arbeiten mit, u. a. »Rodogune. Verkehrte Welt« (Regie: Sarah Klöfer), die zum Körber Studio Junge Regie eingeladen wurde. Bereits während des Studiums spielte sie am Deutschen SchauSpielHaus in der Produktion »Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino« (Regie: Katie Mitchell) sowie in Jean Genets »Die Neger (Les Nègres)« (Regie: Johan Simons).
Seit der Spielzeit 2014-15 gehört Gala Othero Winter zum Ensemble des Deutschen SchauSpielHauses. Für ihre Rolle als Frida Foldal in Karin Henkels Inszenierung »John Gabriel Borkman« wurde sie 2015 mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet. 2016 erhielt sie den Boy-Gobert-Preis der Körber-Stiftung. Zu sehen war sie u. a. in der Regie von Victor Bodo (»Ich, das Ungeziefer«), von Christoph Marthaler (»Die Wehleider«), von Herbert Fritsch (»Die Kassette«) sowie von Simon Stone, bei dem sie eine der drei Titelfiguren in »Peer Gynt« spielte. Aktuell ist sie in »Der goldene Handschuh« und »Der Kaufmann von Venedig« zu sehen.
… Ich wurde einige Male von Inszenierungen, Texten und Schauspielern überrumpelt, die mir mit aller Kraft, Können und Dringlichkeit zeigen wollten, was ich unbedingt zu denken und zu fühlen habe. Es war laut, groß, viel und sehr effektvoll. Ich wurde oft verführt und glaubte, ich hätte meine/n Preisträger/in gefunden Bis ich Gala Othero Winter sah, als Tochter Frida in Karin Henkels Inszenierung von Ibsens „John Gabriel Borkman“. Laut Autor: ein 15-jähriges Mädchen. Auf der Bühne stand ein zartes und zerbrechliches, aber doch selbstbewusstes Wesen, noch desorientiert und deshalb voller Sehnsüchte.
Gala Othero Winter konnte mir etwas erzählen, über einen Menschen und eine Situation. Und dazu brauchte sie nicht viel. Ihr hilflos-aufdringlicher Blick, die kaputten sparsamen Bewegungen, die Stimme bei ihrem unglaublich schönen brüchigen Gesang am Ende der Aufführung. Sie zeichnete ihre Figur mit ein paar Strichen und überließ sie mir, dem Zuschauer.
Die Transparenz, mit der sie das machte, öffnete mir Räume, sie schüttete mich nicht zu mit Behauptungen, sondern gab mir die Freiheit, zu denken und zu empfinden. Was für eine Persönlichkeit! Und das mit 24 Jahren.
Vielen Dank, Gala Othero Winter.
Samuel Finzi / Berlin, 17. Mai 2015
Juror war in diesem Jahr der Schauspieler Samuel Finzi.

Samuel Finzi wurde 1966 in Plowdiw (Bulgarien) als Sohn der Pianistin Gina Tabakova und des Schauspielers Itzhak Finzi geboren. Bereits während seines Studiums an der Staatlichen Theater- und Film-Akademie in Sofia spielte er erste Theater- und Kinorollen und arbeitete im Laufe seiner Karriere mit Regisseuren zusammen, die das europäische Theater und den Film wesentlich prägten: Benno Besson, Jürgen Gosch, Werner Schröter, Robert Wilson, Frank Castorf, Johan Simons, Michael Thalheimer und Dimiter Gotscheff.
Für seine vielgestaltigen, geistreichen Darstellungen wurde er mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Förderpreis für darstellende Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf.
Im März 2015 erhielt er, gemeinsam mit Wolfram Koch, für „Warten auf Godot“ den Gertrud-Eysoldt-Ring.
Samuel Finzi ist der erste Schauspieler, der gleichzeitig Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreis und Teilnehmer am Theatertreffen ist.
Die Preisverleihung fand im Mai 2014 im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2014 ist:

Sie erhielt den Preis für ihre darstellerische Leistung der Njurka in der Aufführung “Zement” von Heiner Müller (Regie von Dimiter Gotscheff) am Residenztheater München.
Valery Tscheplanowa, geboren 1980 in Russland, studierte zunächst Tanz an der Palucca Schule in Dresden und drei Semester Puppenspiel an der Hochschule für Schauspiel “Ernst Busch” in Berlin, bevor sie dort ihr Schauspielstudium absolvierte.
Von 2006 bis 2009 war sie festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Hier arbeitete sie u.a. mit Dimiter Gotscheff und Jürgen Gosch.
Als Ensemblemitglied des Schauspiels Frankfurt (2009 – 2013) wurde Valery Tscheplanowa im Jahr 2011 als “Maria Stuart” unter der Regie von Michael Thalheimer für den Deutschen Theaterpreis “Der Faust” nominiert.
Mit “Zement” gab sie im Mai 2013 ihr Debut am Münchner Residenztheater.
… Das erste Stück, das ich sah, war “Zement” von Heiner Müller in der Inszenierung von Dimiter Gotscheff, eine Bergbesteigung, ein langer und anstrengender Abend, wie sich herausstellte. Aber am nächsten Morgen war ich einverstanden und dachte, ja, Theater darf anstrengen, manchmal muss es anstrengend sein, weil: Es geht um viel. Zu Beginn des Stückes öffnete sich ein Spalt, daraus hervor trat eine Mädchengestalt und sang. Mit immer größerer Kraft.
Und später erzählte sie uns, manchmal berichtete sie, manchmal beschwor sie die Geschichte von Prometheus und von Herakles und einem Adler und von dreitausend Jahren und wieder dreitausend Jahren, die vergangen waren und währenddessen stand sie und stellte sich, klar und erfüllt von ihrer Geschichte, plastisch auch mit den Händen malend – und immer die Mundwinkel etwas nach oben. Naiv und kämpferisch, immer klar und leuchtend. Das war Valery Tscheplanowa, und ich war sehr froh. …
… Und nun kommt meine Entscheidung und ich betone noch einmal, dass sie mir schwergefallen ist. Aber wenn ich nach meinem Herzen gehe, gebe ich mit größter Freude den Preis an Valery Tscheplanowa, die mir am ersten Abend so sehr gefallen hat. Schon gleich als sie erschien und die Bühne betrat, hatte sie mich gewonnen. An ihr hat mir alles gefallen. Und ihre klare leuchtende Stirn, ihr fester und doch leichter Schritt, ihr Singen, ihr Temperament, ihr Humor – das alles hat mich bezaubert.
Auch der russische Klang in ihrer Sprache und das mitreißende russische Lied. Alles war so selbstverständlich und mutig.
Ich gratuliere und wünsche von Herzen, dass ihr die helle Ausstrahlung, ihre Ernsthaftigkeit und Freude erhalten bleiben.
Edith Clever / Mai 2014
Jurorin war in diesem Jahr die Schauspielerin Edith Clever.

Edith Clever ist Regisseurin und eine der bedeutendsten deutschen Schauspielerinnen. Von 1966 bis 1970 gehörte sie dem berühmten Ensemble von Kurt Hübner am Bremer Theater an, wo sie u. a. mit Peter Zadek und Peter Stein zusammen arbeitete. Im gleichen Jahr kam sie mit Peter Stein an die Berliner Schaubühne am Halleschen Ufer, an der sie vor allem in Inszenierungen von Peter Stein zu sehen war, sowie von Klaus Michael Grüber und Luc Bondy. Sie hat mit anderen und im Team das Theater neu gestaltet und berühmt gemacht.
Mit Hans-Jürgen Syberberg verband sie eine enge künstlerische Beziehung, aus der der Film „Parsifal“ und die großen Monologe „Die Nacht“ und Kleists „Penthesilea“ und „Die Marquise von O.“ hervorgingen.1994 kehrte sie als Regisseurin an die Schaubühne zurück.
Zu ihren Auszeichnungen gehören der Deutsche Darstellerpreis (Chaplin-Schuh), der Bayerische Filmpreis, der Gertrud-Eysoldt-Ring und der Nestroy-Theaterpreis als beste Schauspielerin in „Schlaf“.
Neben ihrer reichen Theaterarbeit hat sie in vielen Filmen mitgewirkt. Eric Rohmer verfilmte „Die Marquise von O.“ mit ihr und Bruno Ganz, Peter Handke „Die linkshändige Frau“ ebenfalls mit Bruno Ganz.
Die Preisverleihung fand am 19. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2013 ist:

Sie erhielt den Preis für ihre darstellerische Leistung in „Disabled Theater“ (Regie: Jérôme Bel) am Theater HORA / Stiftung Züriwerk, Zürich.
Julia Häusermann ist das dritte Kind von Esther und Ruedi Häusermann, sie wurde mit dem Down-Syndrom geboren.
Sie schloss 2012 ihre Ausbildung zur Schauspielpraktikerin bei Theater HORA / Stiftung Züriwerk ab.
Meine Damen und Herren, guten Morgen.
Zuallererst möchte ich mich bei Peter von Becker, Peter Böhme und Torsten Maß dafür bedanken, dass sie der Meinung waren, ich könne etwas auf der Bühne beurteilen. Und wie Dante Virgil möchte ich den Herren für ihre kenntnisreiche Begleitung und liebevolle Betreuung danken, auch wenn wir nicht gemeinsam durch Hölle, Fegefeuer und Paradies gegangen sind.
Dank auch an Thomas Oberender, einfach so.
Dann möchte ich Ihnen ein paar Sorgen nehmen, die Sie im Zusammenhang mit meiner Lobrede evtl. beschleichen. Ich werde nichts sagen zu
-der Auswahl des Theatertreffens,
-der Sinnhaftigkeit der Veranstaltung,
-der Sinnhaftigkeit von Preisen für Künstler,
-dem Zustand des deutschsprachigen Sprechtheaters und seiner Protagonisten im Allgemeinen,
-der Relevanz des Theaters in der Gesellschaft.
Außerdem werde ich nicht versuchen, originell zu sein, das sind Sie alle selbst.
Wobei zu einem Thema eine Anmerkung nötig scheint. Es gibt in den letzten Jahren – auch während dieser Veranstaltung konnte man das vor einigen Tagen ausführlich hören – Beiträge verdienstvoller älterer Künstler, die um den Fortbestand des deutschen Theaters fürchten, weil die Arbeitsergebnisse der jüngeren Teilnehmer in vielem nicht mehr den früheren und von diesen Älteren installierten intellektuellen und handwerklichen Kriterien entsprächen. Wobei offenbar davon ausgegangen wird, dass diese Kriterien Manifeste sind und damit für eine wie auch immer geartete Ewigkeit geschaffen.
Das sollte auf Dauer so nicht stehen bleiben. Es ist an der Zeit, dass die Generation um die 40 – die sind ja wohl mit jung gemeint – aus der Deckung kommt und diese grobe Verallgemeinerung seziert. Die sind ja sonst nicht auf den Mund gefallen. Aber vielleicht interessiert die das gar nicht?
Ungeachtet dieser Einschätzungen, die ja doch vor allem sehr persönlich motiviert sind, gibt es natürlich viel Albernes, Anmaßendes, Läppisches, Aufgeblasenes, Semipsychologisches, Besserwisserisches, Weltfremdes und mehr im Theater zu sehen, von jeder Generation, die produziert; in angeblich zeitgenössischer aber in letzter Zeit auch wieder mehr in konventioneller Ästhetik.
Aber es gibt tatsächlich auch ergreifende Künstler unter 70, die nicht mehr wie Kortner sprechen und auch nicht mehr wie Minetti, es gab und gibt Dichter wie Sarah Kane, die schrieben und schreiben nicht mehr wie…- die Namen setzen Sie mal selbst ein – und Regisseure, die inszenieren nicht mehr wie…- die Namen auch. Na Gott sei Dank! Sie versuchen, die Sprache ihrer Zeit zu sprechen und die Zeit ist wie sie ist. Es muss ja Luft ran an das Material auf der Bühne. Wenn wir einen ganz kurzen Blick auf Schwesterkünste werfen: Was hat sich dort in 100 Jahren bewegt! Konsequenterweise klingt John Cage anders als Schubert und ein Penck sieht anders aus als ein Menzel. Woher kommt das seltsame Beharrungsvermögen im Theater, das zyklisch immer wieder auftaucht? Das ist ein Thema für die Frankfurter Akademie; dafür vielleicht einen Preis weniger verteilen.
Einer Zeit kann man – anders als jungen Künstlern – nicht ihre Daseinsberechtigung einfach absprechen, da fährt die Hybris an die Wand. Und obwohl dem Theater mehr und mehr das Geld abhanden kommt, sollte uns nicht der Respekt voreinander abhanden kommen, auch nicht von Älter zu Jünger. Es gab Zeiten, da waren die Alten die Vorbilder. Möglicherweise hat man, wenn man älter ist und berühmt und befriedet und geordnet, nicht mehr ganz die Einsicht in den disparaten Alltag. Das ist zu akzeptieren, kann aber nicht zu der absurden Forderung führen, der eigenen Ästhetik die lebenslange Unkündbarkeit zu verordnen.
Aber wir wollen locker bleiben, es ist Pfingsten und der Anlass unseres Beisammenseins ist ein sehr heutiger: wir wollen einem der faszinierenden jungen Künstler den Alfred-Kerr-Darstellerpreis übergeben.
Ich habe Ihnen auch versprochen, über die Sinnhaftigkeit von Preisen für Künstler, speziell aus unseren Berufen, nicht zu reden. Aber dass Theater, Film und Fernsehen aufpassen müssen, mit ihren jämmerlichen Selbstfeiern, ihrer Preisdiarrhöh, aus einem Beruf für Kräftige, Sensible, Verrückte, Unangepasste nicht einen Beruf für Leistungsträger und Publikumslieblinge zu machen, aus der Bühne und den Schauspielschulen nicht Kadettenanstalten zur Herstellung wirkungsvoller Scheingefühle, dass sie nicht nur die Musterschüler prämieren sollten – die Bemerkung will ich mir nicht verkneifen. Schließlich bin ich auch schon älter.-
Und: Wir können nur Technik lernen und lehren, nicht Talent, nicht Herz, nicht mal Charakter. Unsere Arbeit ist geheimnisvoll, das wusste auch Hamlet. Nur ein Teil der Welt ist erkennbar. Und wer braucht Schauspieler, die auf Knopfdruck so tun können, als weinten sie, als lachten sie?
Zur Hauptsache: Zum Preis. Um ein Motto für die Suche zu haben, habe ich mich an einem Satz von Brecht orientiert. Der hat gesagt: Die Sicherheit treibe ich mir noch aus. Das ist mir gelungen.
Ich habe bei diesem Theatertreffen vor allem Kollektive wahrgenommen – der Star ist die Mannschaft – die mit großem Krafteinsatz an die Rampe stürmen und deren Stürme mir sympathisch waren: Das Kollektiv des Hamburger Thalia Theaters um Thomas Niehaus, Daniel Lommatzsch, Catherine Seifert; „Krieg und Frieden“ aus Leipzig um Manolo Bertling und Birgit Unterweger; die Kölner „Ratten“ mit Lea Schwarz und Jan-Peter Kampwirth; „Orpheus steigt herab“ von den Münchner Kammerspielen mit Risto Kübar und Cigdem Teke; Herbert Fritschs konditionsstarke und formsichere Murmler. Und in der Genration, die meine Jurorenschaft nicht mehr einschließt, bewunderte ich die kompromisslose Wiebke Puls, den ernsten tiefen Andre Schimanski, die beklemmende Lina Beckmann, den geschmeidigen Yorck Dippe, die hingebungsvolle Anette Paulmann.-
Ich habe mich entschieden. Für eine 21 jährige Schauspielerin vom HORA Theater aus Zürich, auch inmitten eines außerordentlichen Kollektivs von Schauspielern, deren Direktheit und Hingabe einzigartig war. Und meine Kriterien – ich hatte ja ein paar – gingen den Bach runter. Wenn der Saint-Exupéry-Satz, dass man nur mit dem Herzen gut sieht, nicht 1000mal missbraucht worden wäre, müsste ich ihn jetzt bringen.
Da sah ich plötzlich den Nachwuchs, die Zukunft: Ganz selbstvergessen, von anarchischem Humor, stiller Aggressivität und so unendlich traurig. Von immenser Kraft und beängstigender Zartheit, ganz weich und auch wie ein Muskel. Jede Bühnensekunde beschäftigt: mit ihrem Spiel, mit ihrer Wut, mit sich, mit der Liebe zu dem Riesen, der neben ihr sitzt. Existenz im Augenblick. Schwermut und Übermut zugleich. Und diese Verlorenheit. Keine Chance, ihr auf irgendeine Technik, eine gesetzte Pointe zu kommen. Kein virtuoses Auftrumpfen und vor allem kein Buhlen um die Aufmerksamkeit und Liebe des Publikums.
Vor mir tauchten Frank Giering, Susanne Lothar, Thierry van Werveke, Ulrich Wildgruber auf, Schauspieler am Rande des Kontrollverlustes, eventuell darüber und gerade deshalb für immer in mir.
Ich habe mich entschieden und ich bin nicht nur zufrieden mit meiner Entscheidung, ich bin glücklich.
Obwohl sie momentan arbeitet und arbeitet, eigentlich auch heute arbeiten müsste und nicht aus der Nachbarschaft anreist, ist die große junge Schauspielerin heute hier.
Ich übergebe voller Freude und mit unendlicher Bewunderung den Alfred-Kerr-Preis 2013 an Julia Häusermann.
Thomas Thieme / 19. Mai 2013
Juror war in diesem Jahr der Schauspieler Thomas Thieme.

Geboren 1948 in Weimar, erhielt Thomas Thieme seine Schauspielausbildung an der Staatlichen Schauspielschule „Ernst Busch“ in Ost-Berlin. Nach Engagements am Theater Magdeburg und am Theater in Halle trat Thieme 1984 eine „legale Ausreise“ nach Westdeutschland an. Dort war er zunächst ein festes Ensemblemitglied am Schauspiel Frankfurt, dann am Burgtheater Wien, an der Schaubühne Berlin, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg.
Sensationell seine Rolle als Richard III in den zum Theatertreffen 2000 eingeladenen „SCHLACHTEN!“ nach Shakespeare (von Tom Lanoye und Luk Perceval, Deutsches Schauspielhaus Hamburg). Von „Theater heute“ wurde er dafür als „Schauspieler des Jahres 2000“ ausgezeichnet. Einmalig auch sein Auftritt in der Titelrolle in „Faust I“ (Regie: Julia von Sell / Karsten Wiegand,
Deutsches Nationaltheater Weimar).
Seit vielen Jahren ist er nicht nur auf dem Theater zu sehen, sondern führt auch Regie. Außerdem hat er in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt.
Die Preisverleihung fand am 20. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2012 ist:

Er erhielt den Preis für seine darstellerische Leistung in René Polleschs Inszenierung „KILL YOUR DARLINGS! STREETS OF BERLADELPHIA” an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin.
Der 1976 in Hamburg geborene Schauspieler begann zunächst Jura zu studieren, wechselte aber dann an die Westfälische Schauspielschule Bochum. Nach dem Abschluss des Studiums war er von 2000 bis 2005 Ensemblemitglied der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin. Hier trat er unter anderem in den Stücken „Paul und Paula”, „Endstation Amerika”, „Forever Young” und „Atta, Atta” auf.
In der Saison 2005/2006 war er bei den Münchner Kammerspielen in „Iphigenie auf Tauris” zu sehen, in der Spielzeit 2010/2011 ebenda in dem Stück „XY Beat” von René Pollesch.
2007/2008 trat er in Schorsch Kameruns Projekt „Biologie der Angst” im Schauspielhaus Zürich auf. Im Rahmen der Wiener Festwochen 2009 spielte er in Schorsch Kameruns „Bei aller Vorsicht” den Profi aus Deutschland.
Seinen ersten Filmauftritt hatte er in der 2003 gedrehten und 2004 uraufgeführten schwarzen surrealen Komödie „Schussangst” in der Hauptrolle des Lukas Eiserbeck. 2005 folgte als eine seiner bekanntesten Rollen die des Hans Scholl im Oscar-nominierten Spielfilm „Sophie Scholl – Die letzten Tage”.
Für die Rolle des Bankers Frederick Feinermann im Film „Schwerkraft” erhielt Fabian Hinrichs 2010 beim Filmfestival Max Ophüls Preis den Sonderpreis Schauspiel.
2010 trat Hinrichs in der Berliner Volksbühne im Solostück „Ich schau dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang!” von René Pollesch auf, mit dem erneut bei der Inszenierung von „Kill Your Darlings! Streets of Berladelphia” zusammen arbeitete.
Fabian Hinrichs ist Mitglied der Europäischen Filmakademie.
Das fing ja gut an. Am ersten Tag des Theatertreffens bekomme ich die Nachricht, dass meine ehemalige Schauspielschule Ernst Busch den ihr zum wiederholten Male zugesprochenen und dringend notwendigen Neubau nicht bekommen soll. Im letzten Moment abgesagt. Eine der renommiertesten Ausbildungsstätten, die den Nachwuchs zu selbstständig denkenden und selbstbewussten Schauspielern ausbildet, war in ihrer Existenz bedroht, und ich sollte nun den Preis für den besten schauspielerischen Nachwuchs vergeben!
Wo soll der denn in Zukunft herkommen, wenn so unverantwortlich und nachlässig mit der Ausbildung junger Kulturschaffender umgegangen wird? Aber die Politikerinnen und Politiker haben nicht mit der Kraft der Studenten gerechnet.
Sie haben in der folgenden Woche großartig, mit beachtlichem Durchhaltevermögen und viel Kreativität um ihre Ausbildungsstätte gekämpft, und mit geballter Kraft und mit der Hilfe vieler Kulturschaffender und Journalisten konnte eine Wende herbeigeführt werden. Das ließ mich wieder aufatmen, und ich konnte mich ganz meiner Aufgabe widmen. Was wiederum nicht ganz einfach war dieses Jahr.
Ich habe mehrere junge Talente gesehen, bei denen ich etwas ahnen konnte von ihrer Kraft, ihrer Leidenschaft fürs Spielen, ihrer Eigenheit. Aber oftmals waren die Aufgaben nicht so groß oder die Setzung des Regisseurs oder der Regisseurin so stark, dass die Eigenheit und Besonderheit des Spielers sich nicht genügend Raum schaffen konnte.
Dennoch gab es da Momente, die ich nicht unbenannt lassen möchte. Der Moment im „Faust“, in dem mich plötzlich eine Stimme im Mark berührt. Es ist die zarte, klare und durchdringende Stimme von Birte Schnöink als Homunkulus, die mich aufhorchen ließ und die sich später ganz pur und offen und umwerfend komisch als kleines Mädchen in mein Gedächtnis einschrieb.
Dann natürlich „Die Spanische Fliege“, die mir vor Lachen Tränen in die Augen trieb. Hier fiel es mir schwer, einen jungen Nachwuchsdarsteller herauszupicken, da alle – von Bastian Reiber über Christoph Letkowski bis hin zu Inka Löwendorf – ihre Sache mit so viel Verve, Mut zum Risiko, Lust am Nonsens, gepaart mit großem komödiantischem Talent, gemacht haben. Oder Ida Müller in „John Gabriel Borkman“ als Erhart, die mich mit ihrer Körperlichkeit in den Bann zog. Irgendwann habe ich mich gefragt: Wie mache ich das jetzt? Worauf kommt es mir wirklich an?
Ich wollte etwas entdecken, was mich überrascht. Etwas oder besser: jemanden, zu dem mein Bauch sofort „ja!“ sagt. Und dann erst wollte ich darüber nachdenken, was da eigentlich gerade mit mir passiert ist und warum. Ich habe mich dazu entschieden, den Nachwuchsbegriff etwas zu erweitern, denn Nachwuchs im eigentlichen Sinne ist der diesjährige Preisträger wahrscheinlich nicht mehr. Und auf der anderen Seite eben doch: Denn er verspricht noch so viel.
Was interessiert mich an diesem Beruf des Schauspielers? Was fasziniert mich, wenn ich da unten sitze und Menschen bei dieser erstaunlichen Arbeit zusehen kann? Diese Momente der Wahrheit, der Echtheit, der Unvorhersehbarkeit, der absoluten Neugier auf das Leben mit all seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit. Etwas nicht Greifbares, sich meiner Ratio Entziehendes. Ein Wunder, welches in den besten Momenten auf der Bühne entstehen kann, weil diese Momente einmalig sind und nicht wiederherzustellen und man sie in diesem Augenblick mit anderen teilt. Um diese Momente zu erwischen, bedarf es einer großen Offenheit und auch Unabhängigkeit und Sicherheit im Spiel. Und diese Momente habe ich gleich in der ersten Inszenierung, die ich für das Theatertreffen gesehen habe, erleben können.
Es war „Kill your Darlings!“ von René Pollesch an der Volksbühne und der diesjährige Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreises ist: Fabian Hinrichs. Hinrichs hat etwas Außergewöhnliches. Ich habe jemandem zusehen können, der eine solche Eigenart besitzt, dieses Ungreifbare und dadurch so „Gefangennehmende“. Ein Mensch mit Haltung, einem Selbstverständnis, der sich ganz meiner Einordnung entzieht und von dem man immer mehr auf der Bühne sehen will, weil er einen „entdecken“ lässt.
Er macht mir einen Vorschlag zum Nachdenken und dabei belehrt er mich kein einziges Mal. Ich darf ihm beim Verfertigen seiner Gedanken zusehen und kann mit ihm auf diese Reise gehen. Dabei ist er ganz und gar nicht harmlos. Im Gegenteil. Ich sehe zum Beispiel einer Turnstunde zu, die einen „Mehrwert“ braucht, weshalb Fabian Hinrichs sich in ein Krakenkostüm begibt, die Lichter flackern und Diskomusik in den Raum dröhnt. Er wiegt mich hier für Augenblicke in Sicherheit, ich kenne mich aus, verstehe worauf das alles hinzielt und denke, ich kann mich wappnen. Und im nächsten Moment stellt er ein „Warum machen wir das?“ in den Raum, von dem man sich erst mal erholen muss, da es mit so einer ehrlichen Verzweiflung, fast kindlich und dann auch seltsam erschöpft vom Leben auf einen niederfährt.
Genauso wie sein „Früher haben sich die Menschen doch mal aus Liebe umgebracht“. Völlig unvermittelt kommt das, wenn er hier von der fehlenden Leidenschaft und Hingabe spricht. Von diesem Wahn, alles einzuordnen und erklärbar zu machen, damit es sich vermeintlich besser aushalten lässt und der den Zugang zu unseren Impulsen und echten leidenschaftlichen Gefühlen versperrt. Bei denen man sich zwar verrennen kann, die einen aber das Leben spüren lassen. Das Frappierende daran ist die Ehrlichkeit und Purheit.
Er spielt mit einer großen Körperlichkeit, immer in Bewegung, dabei nie hektisch, aber immer auf der Suche. Er ist geschmeidig und selbstverständlich auf der Bühne. Er kann übergangslos vom Witzigen ins Traurige, ins Verzweifelte springen. Er spielt mit dem Publikum mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit und Selbstsicherheit und bleibt dabei gänzlich uneitel. Er hält sich aus, muss nicht „nachdrücken“, um sich verständlich zu machen. Er scheint unabhängig von unserem Zuspruch und gerade dadurch hat er den Zuschauer in der Hand. Ein kluger, intelligenter, instinktvoller Schauspieler und eben Nachwuchs, weil da noch so viel mehr zu entdecken ist.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Fabian, zum Alfred-Kerr-Darstellerpreis!
Nina Hoss / Berlin, 20. Mai 2012
Jurorin war in diesem Jahr die Schauspielerin Nina Hoss.

Nina Hoss, geboren in Stuttgart, sprach bereits mit sieben Jahren Hörspielrollen und stand mit 14 zum ersten Mal auf der Bühne. Trotz ihrer frühen Filmerfolge ließ sie sich nicht beirren, 1999 ihr Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ abzuschließen. Davor hatte sie schon Auftritte an der Württembergischen Landesbühne Esslingen in Inszenierungen ihrer Mutter,
der Schauspielerin Heidemarie Rohweder, die Intendantin des Theaters war.
Seit 2001 gehört sie dem Ensemble des Deutschen Theaters an. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie mit Einar Schleef, Michael Thalheimer, Robert Wilson, Luc Bondy, Martin Kusej, Stefan Pucher und Stephan Kimmig zusammen.
Für ihre Darstellung der MEDEA von Euripides in der Inszenierung Barbara Freys verlieh ihr die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste 2006 den Gertrud-Eysoldt-Ring. Ebenso vielfältig wie die Theaterrollen sind seit 1995 ihre zahlreichen Filmrollen.
Zu ihren Auszeichnungen zählen der Adolf-Grimme-Preis, der Deutsche Filmpreis und 2007 der Silberne Bär für YELLA in der Regie von Christian Petzold, der auf der diesjährigen Berlinale für BARBARA mit Nina Hoss in der Titelrolle einen Silbernen Bären für die beste Regie erhielt.
Die Preisverleihung fand am 22. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2011 ist:

Sie erhielt den Preis für ihre schauspielerische Leistung in Karin Beiers Inszenierung „Das Werk/Im Bus/Ein Sturz“ und die Rolle der Warja in „Der Kirschgarten“ in der Regie von Karin Henkel am Schauspiel Köln.
Lina Beckmann wird 1981 in Hagen geboren. Ihrer Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule Bochum folgen Engagements am Schauspielhaus Bochum und am Schauspielhaus Zürich, bevor sie 2007 mit Beginn der Intendanz von Karin Beier ans Schauspiel Köln wechselt.
Es hat mir großen Spaß gemacht, auf die übliche Frage, „Was machen Sie denn zurzeit, Frau Mattes?“, antworten zu können: „Ich
bin die Jury, die Jury für den Alfred Kerr-Preis!“ Also die alleinige Bestimmerin. Ich musste niemanden auf meine Seite ziehen als mich selbst. Zum ersten Mal hatte ich die Zeit, alle Inszenierungen des Theatertreffens zu sehen, es war mir eine süße Pflicht, und auch wenn mir nicht jede Aufführung zusagte, saß ich am nächsten Abend wieder genauso gespannt und offen für alles, was da auf mich zukam, in der sechsten Reihe Mitte.
Ich ging ganz gelassen an die Sache heran. Der oder die Richtige wird sich schon finden. Von zehn Aufführungen haben mich zwei wirklich umgehauen. Die eine war von der Gruppe She She Pop: „Testament“. (Auf die andere werde ich später eingehen.) She She Pop haben sich mit einfachen, aber sehr überzeugenden Mitteln, anhand von König Lear mit ihren echten Vätern über Erbe, Altenpflege, und Liebe zwischen Vater und Tochter auseinandergesetzt. Dieser Abend hat mich sehr berührt, ich durfte nachdenken, mitdenken, ich mag es, wenn meine eigene Fantasie sich dazugesellen kann zum Geschehen auf der Bühne. Ob ich wohl einen der Väter, trotz hohen Alters, weil er eben zum ersten Mal auf der Bühne stand, als besten Nachwuchsdarsteller wählen könnte, ging mir so nebenbei schmunzelnd durch den Kopf.
Nun aber doch zu den jungen, hoffnungsvollen Schauspielerinnen und Schauspielern, allen voran die Gruppe aus dem Ballhaus Naunynstraße, ein wirklich bemerkenswertes Theater der freien Szene. „Verrücktes Blut“, ein tolles, raffiniertes Stück, mit großem Einsatz und voll Herzblut gespielt. Gäbe es eine „Lobende Erwähnung“ beim Theatertreffen, ich würde sie diesem Ensemble aussprechen.
Auch Christian Friedel als Don Carlos vom Schauspielhaus Dresden hat mich beeindruckt. Ich habe mir diese Aufführung sogar zweimal angesehen, ich wollte wissen, ob er mich am zweiten Abend vollends rumkriegt, wo ja die Aufregung und somit der Druck der Premiere, der, wie ich finde, oft positiven Müdigkeit und Entspannung weicht.
Schließlich „Nora oder ein Puppenhaus“ aus Oberhausen, virtuos gespielt von Manja Kuhl als exaltierte Kindfrau. Das schrille Bild dieses Abends, die Lust aller Schauspieler an dem Wahnsinn ihrer Figuren spielte sich auch am nächsten Tag noch vor meinem inneren Auge ab.
Die erste wirkliche Gefährdung meiner sich immer mehr erhärtenden Wahl zeigte sich mir in „Die Beteiligten“ aus Wien. Simon Kirsch war ein Konkurrent, weil er gewisse Ähnlichkeiten hat zu meinem Favoriten, oder meiner Favoritin. Er ist in seinem Spiel sehr direkt, offen und uneitel, spielt und singt selbstsicher, gekonnt, ohne sein Können aufzudrängen. Er hatte nicht so viel zu spielen, dafür aber sehr unterschiedliche Figuren, und die zeichnete er sehr genau, ohne dabei seine Persönlichkeit zu verlieren. Ich kann ihn mir in vielen Rollen vorstellen, vor allem in den schillernden bösen, und da er sehr jung ist, hat er sicher noch die Chance auf diesen begehrten Preis.
So, ich komme jetzt auf den ersten Abend zurück, auf „Das Werk/Im Bus/Ein Sturz“ von Elfriede Jelinek in der Regie von Karin Beier. Die Eröffnung des diesjährigen Theatertreffens, die andere Inszenierung, die mich umgehauen hat, die mich wirklich und nachhaltig begeisterte. Aktuelles politisches und ästhetisches Theater voller Überraschungen, die Sprache, die Inhalte so fantasievoll umgesetzt, staunenswert fand ich das, originell und erfindungsreich. Auf der Bühne eine Riege von gleichermaßen großartigen Schauspielern, Sängern und Tänzern. Und doch war da eine, die herausstach.
Ich dachte, das gibt’s doch gar nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich schon am ersten Abend fündig werde, darauf war ich noch gar nicht richtig eingestellt. Aber von dem Augenblick an, als sie zum ersten Mal den Mund aufmachte und den Zuschauer direkt und unverblümt ansprach, suchten meine Augen sie im Getümmel auf der Bühne. Jedes Mal, wenn sie irgendwo im Hintergrund ververschwand, dachte ich nach kurzer Zeit, wo ist jetzt Meine, diese Unverschämte, die mit dem Publikum spricht, als wäre sie die Kassiererin in dem Laden an der Ecke: alltäglich, selbstverständlich, gewöhnlich, und gleichzeitig springt sie einen an mit ihrer Intensität und Strahlkraft. Sie ist aufmunternd, schwatzhaft, tumb, grazil, und hat eine mordsmäßige Kraft. Ihr leichter Zungenschlag, mit dem sie so selbstbewusst umgeht, als hätte sie ihn erfunden, ist nur einer der vielen Anziehungspunkte dieser jungen Schauspielerin Lina Beckmann.
Einmal spielt sie eine Mutter, deren Sohn bei der Arbeit im Berg tödlich verunglückt ist. Sie kauert am Boden, hält ihr Kind wiegend im Arm, klagt, heult und schreit, wie wir es aus den Nachrichten von den verzweifelten Kriegsmüttern kennen, und im nächsten Augenblick unterbricht sie sich und fordert eine Kollegin auf, die rechts vorne auf der Bühne raucht, die Zigarette auszumachen. Übergangslos schlägt sie einen komplett anderen, sachlich, strengen Ton an, um sich genauso übergangslos wieder in das Elend der trauernden Mutter zu stürzen.
Wir durften Lina Beckmann gleich an zwei Abenden bewundern, eben in „Das Werk“ und im „Kirschgarten“, wo sie die Warja als eine handfeste, einfache Person spielt, die als Einzige versucht, die Verantwortung für diesen zerstreuten, träumenden Kirschgärtner zu übernehmen. In der letzten Begegnung mit Lopachin, bei dem missglückten Heiratsantrag, zeigt sie sich anrührend zerbrechlich und wischt ihren zerstörten Traum, an den sie sich sowieso nicht traute zu glauben, mit einem kurzen, lakonischem „Nö“ von der Bühne. Das war’s, das Leben geht weiter.
Lina Beckmann ist mir nahegerückt durch ihr Spiel und hat mich das ganze Theatertreffen hindurch begleitet. Sie hat mich nicht mehr losgelassen, bei all meiner Liebe zu den anderen hoffnungsvollen Begabungen ließ sie sich nicht verdrängen. In dem Stück von Elfriede Jelinek, in dem es um den Kampf gegen die Natur geht, ist sie selbst eine Naturgewalt, und dabei auch noch sexy, das kommt ja auch nicht so oft vor im Theater, egal ob Mann oder Frau. Sie flüchtet sich niemals in Manierismen, bleibt provozierend natürlich, selbst wenn sie die kompliziertesten Texte kunstfertig, in rasender Geschwindigkeit unglaublich deutlich spricht, schreit, kreischt oder einfach ganz nebenbei leise fallen lässt. She’s a natural woman, sie beherrscht die Bühne.
Eva Mattes / Berlin, 22. Mai 2011
Jurorin war in diesem Jahr die Schauspielerin Eva Mattes.

Eva Mattes, Tochter der Schauspielerin und Tänzerin Margit Symo und des Komponisten und Dirigenten Willy Mattes, steht seit ihrem 12. Lebensjahr auf der Bühne und vor der Kamera.
Seit 1966 war sie in mehr als 200 Theaterinszenierungen und Filmen zu sehen. Sie wirkte in zahlreichen Hörspielen mit und ist die einprägsame und beliebte Stimme bei einer Vielzahl von Hörbüchern. Zu ihren Regisseuren zählten Peter Zadek, Rainer Werner Fassbinder und Werner Herzog.
Für ihre schauspielerische Arbeit wurde sie mit vielen Preisen und Auszeichnungen geehrt. Beim Theatertreffen war sie zum ersten Mal 1973 mit STALLERHOF von Kroetz, eine Inszenierung vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg zu Gast und ist danach oftmals wiedergekehrt.
Mit ihren Liederabenden und Lesungen reist sie seit einigen Jahren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Die Preisverleihung fand am 24. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2010 ist:

Er erhielt den Preis für die Rolle des Pinneberg in Hans Falladas „Kleiner Mann – was nun?“ in der Regie von
Luk Perceval, das von den Münchner Kammerspielen zum Theatertreffen eingeladen war.
Paul Herwig wurde 1970 in Berlin geboren, nahm privaten Schauspielunterricht bei Eike Steinmetz und Marcella Rehm.
Von 1990 bis 1994 besuchte er die Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Sein erstes Engagement trat er 1995 am Bayerischen Staatsschauspiel München an. Dort arbeitete er u.a. mit Michael Bogdanov, Klaus Emmerich, Matthias Hartmann, Andreas Kriegenburg, Hans Neuenfels, Amelie Niermeyer, Armin Petras und Anselm Weber.
1998 wurde er mit dem Staatlichen Förderpreis im Bereich Darstellende Kunst des Landes Bayern und 2000 mit dem Förderpreis des Vereins der Freunde des Bayerischen Staatsschauspiels ausgezeichnet.
Von 2001 bis Ende der Spielzeit 2007/08 war er Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Darüber hinaus arbeitet Paul Herwig für Film und Fernsehproduktionen.
“Dieser Schauspieler kniet, er spricht mit seinem kleinen Sohn, wie ein Bauchredner macht er das, und das Söhnchen auf dem Schoß ist ein Stofftier, ein Bär. Der Mann ist verzweifelt. Er erzählt dem Kind vom Wasser, dem Bach, an dem er kniet. Er nimmt die Hochgeschwindigkeit aus seinem Spiel.
Er ist sehr verletzlich, schmal, ruhig und jung.
Es ist eine stille, poetische Szene, aber jäh und heftig nagt etwas in mir (dem Zuschauer), denn ich verstehe auf einmal, dass ich Zeuge der Vorbereitung eines Selbstmordes geworden bin. Das ist äußerst berührend.
Dieser Schauspieler heißt Paul Herwig und ist ab jetzt der Träger des diesjährigen Alfred-Kerr-Preises.
Gegoogelt ist Paul Herwig nicht wirklich ein total ganz junger Mann und weit entfernt davon, ein Anfänger zu sein. Die Liste seiner spielerischen Unternehmungen, viele beim Film und Fernsehen, ist beeindruckend und er hat auch schon Preise bekommen. Trotzdem habe ich ihn zum ersten Mal auf einer Bühne gesehen (mea culpa) und ich habe mich schon sehr sehr gefreut darüber, wie er das gespielt hat, den Pinneberg in Falladas “Kleiner Mann – was nun?”, und dass ich ihn gleich beim ersten Mal so toll und anrührend erleben konnte.
Er kann so schnell und so agil sein, er wirkt so unverschämt jung. Seine Mutter brüllt er an, sein “Lämmchen” himmelt er an, und der Anblick seines Söhnchens macht ihn stumm vor Zärtlichkeit.
Er schwebt immer irgendwie in der Luft, auch wenn er schwer geschlagen ist. Ja, und er lässt mich ins Innere sehen, in seines, in Pinnebergs – und damit auch in mein eigenes. Und das ist der Kern und die Sache, und ohne sie bin ich verloren, nicht nur als Juror.
Denn die anderen glücklichen Momente in diesen 14 Tagen, außer denen, die Paul Herwig mir schenkte – bei ihm ging das über drei Stunden – kamen auch genau aus diesem Punkt. Schauspieler ließen mich in ihr Inneres blicken, doch genau das ist die Sache der superpräsenten Regisseure dieses Theatertreffens nicht. Sie scheuen Identifikatorisches wie der Teufel das Weihwasser. Ihr Element ist Comedy, Chor und Kabarett. Und das nimmt mir als Juror oft die Möglichkeit, junge Schauspieler gerecht zu beurteilen. Zumal sie angehalten zu sein scheinen, ihre darstellerischen Ausdrucksmittel eher am deutschen Vorabendprogramm zu orientieren als, sagen wir, an denen von Fritz Kortner oder ihrer eigenen Fantasie.
Aber nun habe ich Paul Herwig entdeckt und ihn für diesen Preis vorschlagen können, und das versöhnt mich dann doch mit manchem. Also ich gratuliere dir, Paul. Sehr von Herzen.
P. S. Noch eine kleine Anregung: Liebe Festspielleitung, verzichtet auf den Etikettenschwindel. Das waren nicht die zehn besten oder bemerkenswertesten Inszenierungen, bestenfalls die Top Ten. Und so solltet Ihr es auch nennen.”
Bruno Ganz / Berlin, 24. Mai 2010
Juror war in diesem Jahr der Schauspieler Bruno Ganz.

Bruno Ganz, geboren in Zürich, besuchte dort auch die Hochschule für Musik und Theater.
Über das Junge Theater Göttingen kam er 1964 nach Bremen. Nach kurzer Zeit am Zürcher Schauspielhaus gehörte er von 1970 an zum Ensemble der Schaubühne in Berlin.
Er ist einer der größten Schauspieler deutscher Sprache und seit 1996 Träger des Iffland-Rings. Diese bedeutendste Auszeichnung für einen Schauspieler ist nur einer von vielen Preisen, mit denen Bruno Ganz für seine herausragende Theaterarbeit geehrt wurde.
Die Liste seiner Rollen ist lang und dokumentiert die Zusammenarbeit mit den großen Regisseuren seiner Zunft: Peter Stein, Peter Zadek, Claus Peymann, Luc Bondy und vor allem auch Klaus Michael Grüber.
Seit er Anfang der 60er Jahre begann, neben seiner Theaterarbeit auch Filme zu drehen, reihte er auch hier einen Erfolg an den anderen. Gemeinsam mit Iris Berben ist er Präsident der Deutschen Filmakademie.
Die Preisverleihung fand am 17. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2009 ist:

Sie erhielt den Preis für die Rolle der Nina in „Die Möwe“ in der Inszenierung von Jürgen Gosch am Deutschen Theater in Berlin.
Kathleen Morgeneyer wurde 1977 in Erlabrunnen geboren. Ihre Schauspielausbildung erhielt sie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin.
Seit der Spielzeit 2006/07 gehört Kathleen Morgeneyer fest zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses. In einer Kritikerumfrage wurde sie 2007 als beste Nachwuchsschauspielerin in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.
Ich habe mich sehr gefreut, als man mich anrief, um zu fragen, ob ich Jurorin für den diesjährigen Alfred-Kerr-Preis sein möchte. Es klang verlockend und aufregend, dass ich diese Aufgabe allein übernehmen sollte. Darin liegt natürlich eine große Verantwortung. Doch es war für mich eben auch eine große Freude, weil ich – als Schauspielerin selber zum ersten Mal in der Rolle einer Jurorin – sehr aufmerksam hinsehen musste, um das Gesehene und Gefundene auch beschreiben zu können.
Seit einiger Zeit beobachte ich sehr wach bei den jungen Kollegen eine zunehmende Selbstständigkeit und großes Selbstbewusstsein, was mich sehr verwundert, weil unsere Generation nicht mit so viel Freiheit
aufgewachsen ist. Es gab mehr Autorität und Ängstlichkeit, wir kannten dieses Selbstbewusstsein nicht. Darum macht es mich glücklich, wenn ich diese Kraft und Liebe zu unserem Beruf bei ihnen spüre.
Dieses Theatertreffen hatte viele junge Gesichter. Oft allerdings traten sie wie im Kafka-„Prozess“ der Münchner Kammerspiele oder bei den Hamburger „Räubern“ nur im Chor auf – wenige haben sich als Einzelne dabei in den Vordergrund gespielt.
Ganz besonders ausgeprägt fand ich allerdings die Ausstrahlung einer jungen Schauspielerin, die ich während des Theatertreffens zum ersten Mal gesehen habe. Mit großer Ernsthaftigkeit entwickelt sie ihre Figur, die mit einer anfänglichen wunderbaren Schwärmerei für ihren zukünftigen geliebten Beruf und ihren Träumen beginnt. Im Laufe des Abends sehen wir die Entwicklung einer Frau, die durch große Klarheit und Ehrlichkeit ihrer Situation gegenüber zeigt, dass sie erwachsen geworden ist. Sie hat gelitten, sie fürchtete verzweifelt, dass sich ihre Schauspieler-Träume nicht erfüllten. Aber sie entzieht sich dennoch nicht der Wahrheit, sondern steht zu ihr.
Die junge Schauspielerin, die ich meine, ist in ihrer Zartheit und Sensibilität und Stärke außerordentlich glaubwürdig. Das heißt: Sie spielt nicht, nein, sie lebt auf der Bühne. Ich spreche von Kathleen Morgeneyer.
Sie hat mich als Nina in „Die Möwe“ von Anton Tschechow in der Inszenierung Jürgen Goschs am Deutschen Theater Berlin sehr berührt.
Wo kommt sie her? Aus Chemnitz. Sie lebte auch in Leipzig, und bereits als junges Mädchen war sie so theaterbegeistert, dass sie schon früh das Gymnasium verließ, um auf eine Schauspielschule zu gehen. Über ihre Bewerbung an der Ernst-Busch-Schule sagt sie selbst: „Hat aber nicht geklappt, da war ich gerade siebzehn. Da haben die gesagt, ich soll nochmal wiederkommen. Das habe ich aber sechs Jahre nicht gemacht. In der Zeit war ich Pantomime.“
Nach diesen sechs Jahren hat sie sich schließlich doch erneut an der Ernst-Busch-Schule vorgestellt, vor allem „weil ich gerne von Anfang an eigentlich mit Sprache arbeiten wollte“. Uns sie wurde sofort angenommen.
Welch ein Glück für die Theaterwelt. Welch ein Glück für das Deutsche Theater Berlin und vor allem für das Düsseldorfer Schauspielhaus, zu dessen Ensemble Kathleen Morgeneyer gehört.
Jutta Lampe / Berlin, 17. Mai 2009
Jurorin war in diesem Jahr die Schauspielerin Jutta Lampe.

Jutta Lampe erhielt ihre Schauspielausbildung bei Eduard Marks in Hamburg. Nach Engagements in Wiesbaden und Mannheim feierte sie ihre ersten großen Erfolge in 1960er Jahren am Theater der Freien Hansestadt Bremen, wo sie vor allem in den Inszenierungen von Peter Stein mitgewirkt hat. Zusammen mit Kurt Hübner, Peter Zadek, Peter Stein, dem Bühnenbildner Wilfried Minks und weiteren Schauspielkollegen kreierte sie den so genannten Bremer Stil. Mit Peter Stein ging sie 1970 nach Berlin, wo das Ensemble, erweitert um den Dramaturgen Dieter Sturm, eine neue Form des Mitbestimmungstheaters gegründet hatte, die Schaubühne am Halleschen Ufer.
In den 30 Jahren ihres Engagements an der Schaubühne am Halleschen Ufer, später am Lehniner Platz, arbeitete Jutta Lampe mit den bedeutendsten Theaterregisseuren zusammen und war unter anderem in folgenden unvergesslichen Inszenierungen zu sehen: „Wie es euch gefällt“ von W. Shakespeare, Regie: Peter Stein (1977); „Kaldewey. Farce“ von Botho Strauß, Regie: Luc Bondy (1982); „Drei Schwestern“ von Anton Tschechow, Regie: Peter Stein (1984); „Orlando“ von Virginia Woolf, Regie: Robert Wilson (1989); „Amphitryon“ von Heinrich von Kleist, Regie: Klaus Michael Grüber (1991), „Der Kirschgarten“ von Anton Tschechow, Regie: Peter Stein (1995); „Stella“ von Johann Wolfgang von Goethe, Regie: Andrea Breth (1999); „Die Möwe“ von Anton Tschechow, Regie: Luc Bondy (2000); „Glückliche Tage“ von Samuel Beckett, Regie: Edith Clever (2002); „Die eine und die andere“ von Botho Strauß, Regie: Luc Bondy (2005). Im Frühjahr 2009 arbeitete sie erneut mit Peter Zadek in „Major Barbara“ von George Bernard Shaw am Schauspielhaus Zürich zusammen.
Im Film hat Jutta Lampe vor allem in den Produktionen von Margarethe von Trotta mitgewirkt, u.a. in „Die bleierne Zeit“ und in „Rosenstraße“. Viele der Schaubühnenproduktionen wurden für das Fernsehen aufgezeichnet („Sommergäste“, „Der Park“, „Drei Schwestern“ u. a.).
Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Theaterpreis der Stiftung Preußische Seehandlung, den Gertrud-Eysoldt-Ring, den Nestroy-Theaterpreis, den Stanislawiski-Preis; mehrfach wurde sie vom Theater heute zur Schauspielerin des Jahres gewählt.
Im Herbst 2009 erscheint im Nicolai Verlag ein Portrait der Schauspielerin mit zahlreichen Fotos von Ruth Walz.
Portrait Kathleen Morgeneyer von Oliver Kranz, gesendet im RBB Kulturradio am 18. Mai 2009
Die Preisverleihung fand am 18. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2008 ist:

Er erhielt den Preis für die Rolle des Bruno Mechelke in „Die Ratten “ in einer Inszenierung von Michael Thalheimer am Deutschen Theater in Berlin.
Niklas Kohrt wurde 1980 in Luckenwalde geboren. Zunächst studierte er zwei Jahre Kultur-, Politik- und Theaterwissenschaft, bevor er 2002 ein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin aufnahm.
Nach seinem Diplom 2006 führte ihn sein erstes Engagement an das Deutsche Theater Berlin, wo er seit der Spielzeit 2005/2006 festes Ensemblemitglied ist. Hier arbeitete er mit Regisseuren wie Jürgen Gosch in »Auf der Greifswalder Straße« und »Ein Sommernachtstraum«, Robert Schuster in »Tartuffe«, Dušan David Parizek in »Die Verwirrungen des Zöglings Törless« und Michael Thalheimer in »Schlaf« zusammen.
Seit der Spielzeit 2007/08 ist er in Thalheimers Inszenierung von »Die Ratten« zu sehen.
Im Kino spielte Niklas Kohrt in Detlev Bucks »Knallhart«, außerdem stand er bei Filmen wie »Mein ganz gewöhnliches Leben« von Dominik Bechtel und »Muxmäuschenstill« von Markus Mittermeier vor der Kamera.
Lieber Herr Sartorius, liebe Iris Laufenberg, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Theaterfreunde !
Als ich vor ein paar Monaten den ehrenvollen Auftrag erhielt, in diesem Jahr Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreises zu werden, habe ich mich sehr gefreut. Zumal der Nachwuchs des Theaters durch meine Berufung zum Professor für Schauspiel an die UdK Berlin, mehr und mehr meine Arbeit und mein Leben bestimmt.
Mit etwas gemischten Gefühlen allerdings dachte ich an die vierzehn Tage im Mai wo es gilt, ein kompaktes Besuchsprogramm von zehn ausgepriesenen Theater-Produktionen zu absolvieren. Es ist nämlich auch anstrengend, fast jeden Abend, neben den anderen beruflichen Tätigkeiten, ins Theater zu gehen, und es ist auch nicht immer die reine Freude.
Es kam anders als ich es befürchtet habe. Es gab bei diesem Theatertreffen neben Enttäuschungen auch, und das ist entscheidend, Überraschungen, Entdeckungen, Beglückendes und magische Momente.
Auf der Suche nach dem magischen Moment!
Das sollte mein Motto werden, um einen jungen Schauspieler zu finden, der mir diesen Augenblick vielleicht schaffen kann.
Wenn ich „junger Schauspieler“ sage, und das schließt naturgemäß „junge Schauspielerinnen“ mit ein, ist es auch ausdrücklich so gemeint, weil der Alfred-Kerr-Darstellerpreis an einen Künstler gehen soll, der ganz am Anfang seines Weges steht, und dem dieser Preis als Zeichen Mut geben soll, die eingeschlagene Bahn weiter zu gehen, um eines Tages ein ganz Großer zu werden, der sich messen lassen kann an so wunderbaren Schauspielern wie: Brigitte Hobmeier, Constanze Becker, Friederike Kammer, Regine Zimmermann, Jens Harzer, Ulrich Matthes, Sven Lehmann, Joachim Meyerhoff, Susanne Wolff und Edgar Selge und die vielen Anderen mehr, die hier in den letzten zwei Wochen zu sehen waren, und die ihren Weg schon gefunden haben.
Die Frage, wie es mit dem Nachwuchs bestellt ist, kann man schnell beantworten: SEHR GUT ! Die jungen Menschen, die derzeit an den Schulen heranwachsen und Ausgebildet werden, und auch die, die an den Theatern engagiert sind und jetzt hier In machen vorzüglichen Aufführungen zu sehen waren, zeugen von großem Talent.
Zurück zum „magischen Moment“.
Ich habe in diesen Tagen einige magische Momente erlebt! Und wenn auch die Großen auf diesem Festival mit beeindruckenden Leistungen hervorstachen, schaffte es ein junger Schauspieler aus dem Dunkel heraus mit seiner Präsenz zu funkeln und mich sofort in Bann zu ziehen. In wenigen Augenblicken entstand eine klar umrissene Figur.
Die Rede ist von der Rolle des Bruno Mechelke in Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“ in der Regie von Michael Thalheimer. Die Rede ist von NIKLAS KOHRT !
Niklas Kohrt ist 28 Jahre alt, studierte zunächst Kulturpolitik und Theaterwissenschaften um dann 2002 ein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin zu beginnen. Noch vor seinem Diplom wurde er 2005 an das Deutsche Theater Berlin engagiert, wo er seitdem festes Ensemblemitglied ist. Hier sah man ihn unter Anderem als Lysander in Shakespeares SOMMERNACHTSTRAUM in der Regie von Jürgen Gosch, als Damis in TARTUFFE in der Regie von Robert Schuster; und mit Michael Thalheimer erarbeitete er SCHLAF von Jon Fosse und eben DIE RATTEN
von Gerhart Hauptmannn.
Die Rolle des BRUNO MECHELKE ist nicht groß und doch gelingt es Niklas Kohrt in wenigen Szenen einen Charakter so zu zeichnen und in Facetten zu erspielen, dass man die Figur den ganzen Abend nicht mehr vergisst. Vor allem in der letzten Szene mit seiner Schwester Jette (Frau John), gespielt von Constanze Becker, gelingt es ihm, in einem Wechselbad von Komik und Grauen, dichte
atmosphärische Momente von Tragik zu schaffen. Obwohl seine Figur brutal, bedrohlich und abstoßend wirkt, ist sie berührend. Das Blut unter der Nase sieht aus wie die klaffende Wunde eines waidwunden Tieres. Man sieht hinein in die Abgründe eines Menschen mit seinem Schicksal, seinem Leid und seinem Schmerz. Er zeigt einen tief verstörten, zerstörten Menschen, in dem es brodelt, und der vor dem eigenen Abgrund erschrickt.
Niklas Kohrt spielt mit dem Mut zum Risiko eine sozial schwache Figur aus dem Berliner Milieu am Rande der Gesellschaft. Und diese soziale und persönliche Grundkonstellation führt dann auch zur Katastrophe, zum fast zufälligen Mord an Pauline Piperkarcka.
Die Mitteilung, dass er Pauline umgebracht hat, fällt aus ihm heraus wie ein schwerer, unverdaubarer Brocken: „Heute morjen halb viere hätt‘ se det Jlockenläuten noch heeren jekonnt“.
Ich war auf der Suche nach einem jungen Schauspieler, der tatsächlich eine Figur erspielt, und nicht gezwungen ist, nur plakative Sprachakrobatik zu vollführen.
Wenn Einer wie der 28-jährige Niklas Kohrt eine Rolle so mit innerer Freiheit und überlegener Ruhe, die für diese Gestaltung notwendig ist, so ergreifend und berührend darstellen, besser gesagt SPIELEN kann, dann ragt er heraus, ist beeindruckend und bemerkenswert. Ein Schauspieler, der aus dem Dunkel leuchtet, einer, der zu großen Hoffnungen Anlass gibt: Ein würdiger Alfred-Kerr-Preisträger.
Herzlichen Glückwunsch NIKLAS KOHRT !
Gerd Wameling / Berlin, 18. Mai 2008
Juror war in diesem Jahr der Schauspieler Gerd Wameling.

Gerd Wameling, 1948 in Paderborn geboren, absolvierte seine Schauspielausbildung an der Folkwang-Hochschule in Essen.
Sein erstes Engagement hatte er am Theater am Turm in Frankfurt am Main, wo ihn Peter Stein entdeckte und 1974 nach Berlin an die Schaubühne am Halleschen Ufer holte (ab 1981 Schaubühne am Lehniner Platz). Ihr gehörte er fast 20 Jahre an.
In der Schaubühne fand er ein Theater, das radikal in Ansatz und Anspruch und fern jeder Beiläufigkeit war. Die Inszenierungen hatten Ereignischarakter und erweckten weltweit Interesse. Die Schaubühne wurde zur Pilgerstätte aller Theaterbegeisterten und zum Synonym für ein Ensemble einzigartiger Schauspieler. „Es war eine glückliche Zeit“, wie Gerd Wameling selbst sagt, „und eine reiche Schaffensperiode“.
Seit 1992 arbeitet er frei, u.a. bei den Salzburger Festspielen, und spielte in Berlin in der Bar jeder Vernunft und im Renaissance-Theater. Am Burgtheater Wien kann man ihn immer wieder als Serge in Yasmina Rezas „Kunst“ bewundern.
In Film und Fernsehen war er u.a. in Wim Wenders “In weiter Ferne so nah”, Peter Steins “Trilogie des Wiedersehens”, in der Krimireihe “Bella Block” oder im Tatort “Tödlicher Galopp” zu sehen. Einem breiten Publikum ist er als Staatsanwalt Dr. Fried aus der Serie “Wolffs Revier” bekannt. Nach Filmen mit vielen namhaften Regisseuren, arbeitete er 2007 erneut mit
Wolfgang Panzer bei dessen Remake von Bernhard Wickis Film „Die Brücke“ zusammen.
Seit 1981 unterrichtet Gerd Wameling am Mozarteum Salzburg und an der Universität der Künste, die ihn 2005 zum ordentlichen Professor an die Fakultät Darstellende Kunst berief.
Regelmäßig inszeniert er mit seinen Studenten öffentliche Aufführungen, die von der Theaterkritik lobend gewürdigt werden, wie zum Beispiel „Unter Aufsicht/Die Zofen“ (Genet), „Was Ihr wollt“ (Shakespeare), „Der Streit“ (Marivaux), „Krach in Chiozza“ (Goldoni), „Stags & Hens“ (Willy Russell) am Mozarteum Salzburg, und „Romeo und Julia“ (Shakespeare) an der UdK.
Nicht zuletzt dieser Umstand bewog die Stiftung, ihn für 2008 zum Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreises zu berufen.
Die Preisverleihung fand im Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2007 ist:
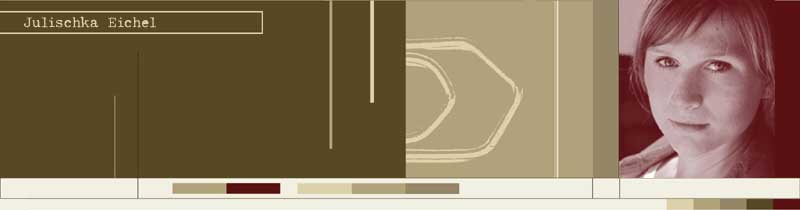
Sie erhielt den Preis für die Rolle der Lucy in Ferdinand Bruckners „Krankheit der Jugend“, Inszenierung Tilmann Köhler, Deutsches Nationaltheater Weimar.
Julischka Eichel, geboren 1981 in Tübingen, Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, Berlin, einige Rollen im Film und Fernsehen. Im Deutschen Nationaltheater Weimar ist sie als Lucy in „Krankheit der Jugend“ von Ferdinand Bruckner, Regie Tilmann Köhler, zu sehen. Zurzeit spielt sie in Maxim Gorki Theater Berlin „herr tod lädt nicht ein aber wir kommen trotzdem“ von Nora Mansmann in der Inszenierung von Tilmann Köhler.
Ergreifend unmittelbar hat Julischka Eichel die Lucy in Ferdinand Bruckners „Krankheit der Jugend“ am Deutschen Nationaltheater Weimar gespielt – und diese Unmittelbarkeit gab den Ausschlag für die Zuerkennung des Alfred-Kerr-Darstellerpreises durch Martina Gedeck. In der Laudatio der Jurorin heißt es: „Mit Leichtigkeit und Virtuosität lässt Julischka Eichel alle Spielarten der Liebe kaleidoskopartig vor den
Augen der Zuschauer aufscheinen. Schier unerschöpflich scheint ihre schauspielerische Phantasie, mit der sie das Zentrum, das Wesen ihrer Lucy zum Leuchten bringt. Ungewöhnlich groß die Spannweite, die sie dieser Figur verleiht.“
1981 in Tübingen geboren und an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin ausgebildet, gehört Julischka Eichel zu einer Generation junger Schauspielerinnen, für die Naivität und Selbstbewusstsein keine Gegensätze sind, sondern einander bedingen. Noch einmal Martina Gedeck: „Sie verschafft dieser Figur Gegenwart, legt Zukünftiges an, lässt Vergangenes aufblitzen und entwickelt sie damit in die Zeitlosigkeit hinein.
Ein großer Zauber ist ihr zu eigen, ein inneres Leuchten geht von ihr aus.“ Von ungefähr kommt dieser Zauber nicht. Julischka Eichel hat schon viele große Rollen gespielt, an der Schauspielschule – Luise und Lady Macbeth, die Karoline in Horváths „Kasimir und Karoline“, die Rita in Thomas Braschs „Lovely Rita“ und viele andere. Auch in Film und Fernsehen ist sie längst entdeckt, auch wenn hier die ihr gemäßen Aufgaben erst noch kommen werden. Das „große“ Theater jedenfalls hat Julischka Eichel auf Anhieb erobert, mit zwei ganz gegensätzlichen Rollengestaltungen. Die „Sie“ in „herr tod lädt nicht ein aber wir kommen trotzdem“ von Nora Mansmann (Studio des Berliner Maxim Gorki Theaters) war ein Mädchen mit pubertär aggressiver Gestik, mit verdrängter Anmut und unterdrückter Zärtlichkeit. Die Lucy dagegen, wie von Martina Gedeck anschaulich und liebevoll beschrieben, verkörperte sie mit geradezu verführerischem Reichtum: kindlich verspielt, melancholisch-elegant und triebhaft sündig.
Dem Berliner Maxim Gorki Theater wird Julischka Eichel treu bleiben – von der Spielzeit 2007/2008 an gehört sie zum festen Ensemble. Bei der RuhrTriennale 2007 spielt sie in der Duisburger Gebläsehalle in „Courasche oder Gott lass nach“ von Wilhelm Genazino mit Barbara Nüsse und Anna Franziska Sma die in drei Lebensaltern auftretende Courasche. Eine Schauspielerin ist auf dem Weg, „mit dem ganzen Frauenwissen im Körper“ – um Martina Gedecks Laudatio kommt man nicht herum.
Sehr verehrte, liebe Judith Kerr, verehrter Günter Rühle, lieber Herr Sartorius, liebe Iris Laufenberg, lieber Peter von Becker, lieber Torsten Maß, lieber Peter Böhme, meine Damen und Herren.
Es ist mir eine große Freude, den diesjährigen Alfred-Kerr-Darstellerpreis heute hier verleihen zu dürfen. Aufgabe war, die eindrücklichste Darbietung eines jungen Schauspielers (ich sage hier der Einfachheit halber „Schauspieler“, das schließt die „Schauspielerin“ natürlich mit ein) zu entdecken, der am Anfang seines Schaffens steht, und diesen Aspekt bedenkend, habe ich mich die letzten 14 Tage auf Entdeckungsreise begeben und habe mich in eine ganz ungewohnte, fremde Position begeben, nämlich in die des Beobachtenden, Abwägenden, Beurteilenden, in die Position des Kritikers, wenn man so will.
Und ein bisschen habe ich versucht, dem wunderbaren Alfred Kerr über die Schulter zu schauen dabei und ihn mit seinem lebens- und theaterbejahenden Blick Leitung sein zu lassen.
Nun ist der Alfred-Kerr-Preis kein gewöhnlicher Theaterpreis, der die größte schauspielerische Leistung des Festivals belohnt. Er ist ausdrücklich ein Preis für den sogenannten Nachwuchs. So wunderbare Schauspieler wie Hans Löw, Sandra Hüller, Christiane von Poelnitz oder Joachim Meyerhoff musste ich also unberücksichtigt lassen und mich statt dessen auf die Suche machen nach einem Schauspieler, der auf der Schwelle steht, der noch nicht auf den großen Bühnen Deutschlands und der Welt zu Hause ist, sondern dem dieser Preis dazu verhelfen soll.
Im „Pariser Tageblatt“ 1937 heißt es über Kerr und die Jugend: „Die Jugend (es handelt sich hier um die radikale bürgerliche Jugend um 1910, aber ich übertrage das Politische mal aufs Theater, ich denke, das ist statthaft) fand in Kerr nicht nur ihren Beschützer und Förderer, sondern empfing von ihm den Pulsschlag, den Drang loszugehen…… Er schuf in jedem Fall Bewegungsmöglichkeiten, Bewegungsfreiheit. Man empfing von ihm das Selbstbewusstsein, sich nicht zu fürchten, die Fesseln der Konvention zu sprengen, sich außer Reih’ und Glied zu stellen“.
In diesem Sinne bin ich fündig geworden.
Ich möchte den Alfred-Kerr-Darstellerpreis der jungen Julischka Eichel verleihen für ihre Rolle der „Lucy“ in „Krankheit der Jugend“. Und möchte die Belobigung mit Kerr beginnen, der das, was einem da begegnet, so schön beschreibt in einer Kritik vom November 1932:
„Nachwuchs: Die junge ……. tritt nach vorn.
Mit Anmut,
unbekümmert,
unversehrt,
unbefangen.
Als wäre kein Publikum da.
Dies ist der Weg.
Ein Gesicht hat sie auch. Also“
Das Spiel der Julischka Eichel scheint mir ganz außergewöhnlich zu sein. Ihre Lucy (das Mädchen Lucy liebt Herrn Freder, der sie benutzt und schließlich auf den Strich schickt) ist von verstörender Unmittelbarkeit. Mit Leichtigkeit und Virtuosität lässt diese Schauspielerin alle Spielarten der Liebe kaleidoskopartig vor den Augen der Zuschauer aufscheinen. Schier unerschöpflich scheint ihre schauspielerische Phantasie, mit der sie das Zentrum, das Wesen ihrer Lucy zum Leuchten bringt. Ungewöhnlich groß die Spannweite, die sie dieser Figur verleiht: Als Verliebte ein Kind, fassungslos erstaunt über die Wucht der Gefühle, die Besitz von ihr ergreifen, ungebärdig im Körper, von überbordender Kraft und die ganze Welt umarmend. Als Hure melancholisch-elegant, das ganze Frauenwissen im Körper, eine Frau von Welt, gänzlich von aller Welt getrennt. Sie verschafft dieser Figur Gegenwart, legt Zukünftiges an, lässt Vergangenes aufblitzen und entwickelt sie damit in die Zeitlosigkeit hinein.
Ein großer Zauber ist ihr zu eigen, ein inneres Leuchten geht von ihr aus.
Das schauspielerische Instrumentarium steht ihr wie selbstverständlich zur Verfügung.
Sie ist persönlich, aber nie privat.
Ihr Spiel ist geführt und gleichzeitig selbstvergessen.
Es zeichnen sich große Möglichkeiten ab, es bleibt mir nur, toi-toi-toi zu sagen.
Und zum Schluss noch einmal Alfred Kerr zu Wort kommen zu lassen mit einer rückblickenden Zukunftsprognose über die junge Schauspielerin aus seiner Kritik 1932, die auch hier gelten soll:
„Nie seitdem hat sie versagt. Allemal ist sie gewachsen. Immer ein Glück.“
Martina Gedeck / Berlin im Mai 2007
Jurorin war in diesem Jahr die Schauspielerin Martina Gedeck.
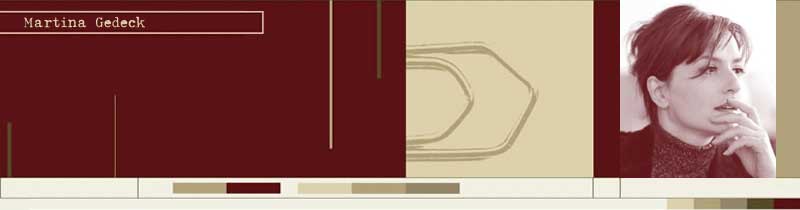
Wenn Selbstbewusstsein das Wesen der jungen Mädchen und Frauen ist, die Martina Gedeck auf der Bühne, im Film oder auf dem Bildschirm gespielt hat, dann ist es ein zögerliches, ein nachdenkliches, ein sehr verletzliches Selbstbewusstsein. Immer ist zu spüren, dass diese Figuren nicht „fertig“ sind, dass sie um sich und ihren Weg ringen, dass sie sich durchsetzen wollen, gegen alle Hindernisse. Dem Zuschauer kommen sie durch ihre Natürlichkeit nahe, sie erwecken Vertrauen, sie bewegen sich im Alltäglichen mit Tapferkeit und Trotz, mit einer Leidenschaft, die anrührend und aufrüttelnd ist.
Martina Gedeck lädt in ihrem Spiel zu Entdeckungen ein, sie stellt Menschen so dar, dass alles Fremde wegschmilzt und man immer mehr über ihre Schicksale erfahren möchte. Auf zurechtgemachte, glatte Schönheit kann Martina Gedeck verzichten – in ihrem ausdrucksstarken Gesicht leben Menschengeschichten mannigfaltiger Art, traurige, heitere, solche voller Zuversicht – und Entsagung. Es sind Geschichten, die sich tief einprägen und nicht vergessen werden können. Offenheit und Freundlichkeit, Schmerz und tiefes Versunkensein sind da zu entdecken, vor allem aber: Ehrlichkeit. Das Glamouröse liegt der Schauspielerin nicht, Pathos und Pose verachtet sie. Was sie spielt, stimmt, ist mit Genauigkeit erarbeitet, weist meisterlich beherrschtes Handwerk vor. So wenig sich Martina Gedeck festlegen lässt, so sehr bleibt sie sich treu. Sie will Lebensnähe, sie will mit ihren Figuren zeigen, was dem Menschen aufgegeben ist und wie er bestehen kann in dieser unserer Welt.
Geboren 1961 in München, seit 1971 in Berlin lebend und dort auch an der Hochschule der Künste (Max-Reinhardt-Seminar) ausgebildet, gehört Martina Gedeck zu den international erfolgreichen, gefeierten Schauspielerinnen unserer Zeit. Theater und Film wird sie gleichermaßen gerecht, auch wenn der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf filmischem Gebiet liegt. In mehr als 50 Kino- und TV-Produktionen hat sie bisher mitgewirkt, stets mit nachhaltigem Erfolg. Im Oscar-gekrönten Film „Das Leben der anderen“ gelang ihr mit der sensiblen, innerlich zerrissenen und doch in ihrem schöpferischen Wollen unbeirrbaren Schauspielerin Christa Maria Sieland eine ihrer überzeugendsten Leistungen. Am Deutschen Theater Berlin spielte sie 2005 die Titelrolle in Lessings „Minna von Barnhelm“. Ihre Minna war eine junge Frau mit unverdorbener erotischer Ausstrahlung, die sich in trotzigen Verdruss wandelt, wenn der Geliebte Major von Tellheim spröde bleibt und das Spiel um Liebe – und Leben – nicht mitspielen will. Auf dem Höhepunkt der Verwirrung zeigte Gedecks Minna Ratlosigkeit, Angst und die Ahnung, dass im Grunde alles verloren ist. Diese drohende Verzweiflung führte die Figur in eine vorher noch nicht ausgelotete Tiefe.
Zwei Jahre nach dieser außergewöhnlichen Rollengestaltung ist Martina Gedeck nun, zum Theatertreffen 2007, Juror für den Alfred-Kerr-Darstellerpreis. Viele der bisher ausgezeichneten jungen Schauspieler und Schauspielerinnen haben sich wie sie zur Arbeit im Theater und im Film bekannt, den Jungen von heute wird sie deshalb Vorbild und Ansporn sein.
Die Preisverleihung fand am 21. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2006 ist:

Er erhielt den Preis für die Titelrolle in der “Platonow”-Inszenierung von Karin Henkel am Schauspiel Stuttgart.
Geboren 1974 in Köln. Er erhielt seine Ausbildung 1996 bis 2000 in Potsdam-Babelsberg. Seine Engagements führten ihn 2000 ans Deutsche Theater Berlin, von 2000 bis 2002 ans TAT Frankfurt, 2003/2004 ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. 2003 spielte er am Theater Basel, in den Sophiensaelen Berlin und im TIF/Staatsschauspiel Dresden. Seit der Spielzeit 2005/06 mit Beginn der Intendanz Hasko Weber festes Engagement am Schauspiel der Staatstheater Stuttgart.
Prägende Rollen am Schauspiel Stuttgart:
Michail Platonow in “Platonow” von Anton Tschechow (Regie: Karin Henkel)
Woyzeck in “Woyzeck” von Georg Büchner (Regie: Thomas Dannemann)
Vicomte de Valmont in “Gefährliche Liebschaften” nach Choderlos de Laclos (Regie: Stephan Rottkamp)
Felix Goeser ist kein sehr junger Schauspieler mehr. Und ist dennoch der Richtige für einen Nachwuchspreis. Er hat erst spät die Schauspielschule absolviert, und der Platonow ist seine erste große Rolle. Er spielt ihn als einen Dandy, der sich selbst parodiert, als Clown, als Hanswurst, als Gaukler. „Als Narr der er ist, der er immer gewesen ist“, sagt Henry Miller über den Clown. Es gibt eine Federzeichnung von Hans Holbein, die man in Basel sehen kann. Sie zeigt einen Narren, der seine Kasperlfiguren zu bewundern scheint. Er hält eine in der Hand, wie einen Spiegel. Sie trägt die gleiche Schellenkappe wie er. Mit der anderen Hand scheint er die Puppe zu necken, zu reizen, auf dass sie lebendig werde.
Mit demselben finsteren, boshaft argwöhnischen Blick, mit derselben lauernden Neugierde, mit derselben neckend aufreizenden Geste spielt Felix Goeser Platonow.
Er befreit sich und das Theater von der Last des Bedenkenträgertums, von der zähen Trägheit der Stilistik, von jeder dekorativen Weinerlichkeit und spielt los. Mit sich und den anderen Fratzen als Zirkusdirektor, Artist, Dompteur – als sein eigener Tiger oder sein eigenes Dressurpferdchen, als dummer August. In den besten Momenten zeigt dieser fuchtelnde Narr auf die Wahrheit und verwirft die akademische Tradition des Wahren, Guten, Schönen als Oberheuchelei.
Aus der Laudatio von Martin Wuttke / Berlin, 21. Mai 2006
Juror war in diesem Jahr der Schauspieler Martin Wuttke.
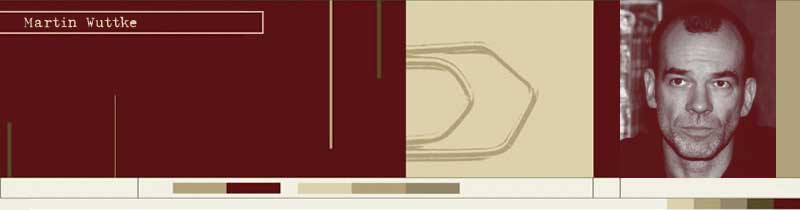
Martin Wuttke, der Alfred-Kerr-Juror des Jahres 2006, zählt zu jenen Künstlern, die in der öffentlichen Wahrnehmung gern mit einer Paraderolle identifiziert werden – obwohl gerade er ein Beispiel für Vielseitigkeit und die Gabe der Verwandlung bietet.
Doch wenngleich der 1962 in Gelsenkirchen geborene und am Figurentheater-Colleg Bochum sowie an der Westfälischen Schauspielschule ausgebildete Schauspieler mit extrem unterschiedlichen Regisseuren wie Robert Wilson und Einar Schleef,
Kurt Hübner und vor allem Frank Castorf gearbeitet hat, wird sein Name bis heute häufig mit Brechts „Arturo Ui“ gleichgesetzt.
In dieser letzten Inszenierung von Heiner Müller war Wuttke am Berliner Ensemble der machthungrig hechelnde Aufsteiger, der in seiner Pose als Fleisch gewordenes Hakenkreuz eine Theater-Ikone des 20. Jahrhunderts kreierte. Dass er diese Rolle auch nach Müllers Tod weltweit spielte und als „Schauspieler des Jahres“ in Krisenzeiten zum prominentesten Anwalt der Bühne wurde, befähigte Wuttke zudem, das Berliner Ensemble als Intendant über das schwierige Jahr 1996 zu retten. In derselben Saison wurde der Künstler mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring geehrt.
Begonnen freilich hatte Martin Wuttkes Karriere zwölf Jahre zuvor beim Schauspiel in Frankfurt am Main, wo sich der junge Mime Hauptrollen wie Hamlet und Leonce anverwandelte und in Inszenierungen von Einar Schleef prägende Erfahrungen sammelte. Über Berlin und Stuttgart führte sein Weg Anfang der 90er Jahre an das Hamburger Thalia-Theater, wo er 1992 mit dem
Boy-Gobert-Preis geehrt wurde – vor allem für seine Darstellung des Kostja in Tschechows „Die Möwe“. Wenig später spielte er gemeinsam mit Marianne Hoppe in „Quartett“ erstmals unter Heiner Müllers Regie, Schleefs „Wessis in Weimar“ war ein weiterer Meilenstein seiner Karriere am BE. Dass er dem Haus auch nach dem kulturpolitisch begründeten Abschied vom Intendanten-Amt verbunden blieb und Stücke wie „Monsieur Verdoux“ oder „Artaud erinnert sich an Hitler und das Romanische Café“ aus der Taufe hob, darf als weiterer Beleg für Wuttkes künstlerische Integrität gelten.
Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends verlagerte Martin Wuttke sein kreatives Zentrum in die Berliner Volksbühne, wo er in zahlreichen Inszenierungen von Frank Castorf tragende Rollen übernahm. Zudem war der Schauspieler, der 1996 bereits die Uraufführung von Heiner Müllers „Germania 3“ zur Premiere geführt hatte hatte, mehrfach als Regisseur tätig. So inszenierte er in Neuhardenberg „Die Perser“ und „Solaris“. Auch auf der Leinwand ist der vielfach ausgezeichnete und von Kritikern als „Elementarereignis“ gefeierte Künstler immer wieder zu erleben: Bereits 1991 in Rebecca Horns „Buster’s Bedroom“, später u. a. in „Die 120 Tage von Bottrop“ (1997) und in „Die Stille nach dem Schuss“ (2000).
Die Preisverleihung fand am 22. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2005 ist:
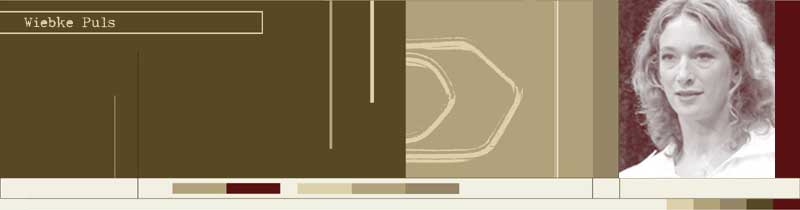
Sie erhielt den Preis für die Rolle der Kriemhild in Hebbels „Nibelungen“ (Regie Andreas Kriegenburg) der Münchner Kammerspiele.
Geboren 1973 in Husum, Ausbildung von 1993 bis 1997 an der Hochschule der Künste in Berlin. Engagements am Schauspielhaus Hannover (1997-1999), am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg (ab 2000) und seit der Spielzeit 2005/2006 an den Münchner Kammerspielen. 2003 Boy-Gobert-Preis für besondere künstlerische Leistungen, 2005 Alfred-Kerr-Preis und Schauspielerin des Jahres der Zeitschrift „Theater heute“
Prägende Rollen (Auswahl):
Caliban (Der Sturm), Hannover; Ellida Wangel (Die Frau vom Meer), Ariel, Prinzessin Lena (Leonce und Lena), Deutsches Schauspielhaus Hamburg; Brunhild, Nibelungen-Festspiele Worms; Hedda Gabler, Deutsches Schauspielhaus Hamburg: Kriemhild, Münchner Kammerspiele
Als Ellida (Die Frau vom Meer), Brunhild („Nibelungen“-Festspiele):
Sie ist die Frau vom Meer. Nur im Wasser würde sie sich verlieren wollen, unten bei den Nixen, den Undinen… Von allen Rollen ist Ellida die ihr am nächsten stehende Figur, eine gestrandete Meerjungfrau, die nicht mehr ins nasse Element zurückzugleiten vermag…Im Sommer hat sie eine Frauenfigur gespielt, die Souveränität aus der Stille, der Unbeweglichkeit holt: Brunhild bei den „Nibelungen“-Festspielen in Worms, „bei ihr ist jeder Schritt ein Tigergang“, das imponiert.
Hella Kemper in „Die Welt“, 2. Dezember 2003
Als Kriemhild „Die Nibelungen“:
„Schwarz gewandet, ragend groß, zeigte Wiebke Puls als Kriemhild die verstörende Wandlung vom naiven, anmutigen Mädchen zu einer keiner menschlichen Regung mehr zugänglichen mythischen Rächerin. Diese schrankenlose Leidenschaft aus eiskaltem Kalkül aber entlarvte voller Grimm das dumme, planlose Metzeln der Männer. Wiebke Puls erhielt aus der Hand des Jurors Ulrich Matthes nur zu Recht den Alfred-Kerr-Darstellerpreis.“
Christoph Funke, Neue Zürcher Zeitung, 25.5.05
Während meiner zwei Wochen als Juror beim Theatertreffen habe ich immer wieder gedacht: Gottseidank bin ich kein Theaterkritiker! Nicht weil mir die Aufführungen nicht gefallen hätten, da gab es Erfreuliches und Enttäuschungen wie jedes Jahr, sondern weil ich nicht darüber schreiben muss! Weil ich mich meinen Eindrücken, meinen Assoziationen und Gefühlen überlassen kann, ohne sie anschließend formulieren zu müssen.
Ich habe vor kurzem bei meiner Dankesrede für den Eysoldt-Ring beklagt, dass Kritiker kaum noch die Arbeit von Schauspielern beschreiben können. Es ist tatsächlich schwer, habe ich jetzt gemerkt. Und zwar deshalb, weil ich gerade in den glückhaften Augenblicken einer Vorstellung den kühleren, professionellen Blick vergessen möchte und mich ganz direkt bewegen, anregen, berühren lassen möchte. Und gerade das Fluidum, die Erotik, die Aura eines Schauspielers, einer Schauspielerin entzieht sich eben bis zu einem gewissen Grad der Ratio und damit der Beschreibbarkeit. (…)
In fünfeinhalb Stunden kann einem ja besonders viel durch den Kopf gehen: ich fand Andreas Kriegenburgs „Nibelungen“ einen hoch anregenden und – das ist ja keine Schande – unterhaltsamen Theaterabend. Über seine Neigung zu Kalauern kann man streiten. (…) Aber – heute – egal! Es geht hier um eine Schauspielerin, von der ich vor diesem Abend immer wieder gehört, sie aber noch nie gesehen hatte: Wiebke Puls. (…)
Sie ist 31, erfüllt also gerade noch eine der Kerr-Preisträger-Kriterien, war sechs Jahre am Hamburger Schauspielhaus engagiert, dort kennt man sie also. In Berlin noch nicht. Das wird sich, hoffentlich, ändern.
Diese Schauspielerin ist tollkühn. Sie wirft sich mit einer Radikalität des Gefühls in die Kriemhild, dass mir zwischendurch das völlig abgeschaffte Wort „Tragödin“ durch den Kopf blitzte. Schönes Wort, warum gibt’s das nicht mehr? Weil niemand mehr Tragödien schreiben kann – und will? Vielleicht sollte man mal einen Wettbewerb für eine Tragödie ins Leben rufen, ich wäre sehr gespannt auf das Ergebnis. In der Realität gibt es sie ja noch, zumindest verkleidet als Bürgerliches Trauerspiel. Außerdem gibt es noch Menschen, die sie spielen könnten, nämlich Wiebke Puls.
Sie ist in ihrer radikalen Entäußerung uneitel – vielleicht in manchen Rollen sogar bis zur Sprödigkeit, kann ich mir vorstellen, und ganz ohne Manierismen: eine hohe Tugend. Ihr Formbewusstsein führt sie an der langen Leine, das macht den Hebbel leichter, intuitiver, weniger streng.
Und: sie hat, und das macht die Sache besonders spannend, Humor. Sie ist in der Lage (…) aus ihren aberwitzigen Hochemotionen „abzutauchen“ in Witz und Spiel und Laune. (…) Sie hat für ihre geschätzten 1,85 viele verblüffend elegante, sehr persönliche, manchmal übrigens auch hier humorvolle körperliche Ausdrucksformen gefunden. Sie ist gedanklich äußerst konzentriert und dicht dran an der schwierigen Sprache Hebbels, und trotzdem gelingt es ihr immer wieder, die Sprache gleichsam zu knacken, sie gewissermaßen von sich selbst zu befreien, Hebbel zu entkrampfen. (…)
Sie ist eine Extremistin der wahren Empfindung.
Sie kann ganz still sein und buchstäblich: furios.
Sie ist auf eine sehr persönliche, mutige Weise als Kriemhild das, was Alfred Kerr eine „leuchtende Seelenschauspielerin“ genannt hat.
Ich gratuliere Ihnen zum Alfred-Kerr-Preis von Herzen.
Ulrich Matthes / Berlin, 22. Mai 2005
Juror war in diesem Jahr der Schauspieler Ulrich Matthes.
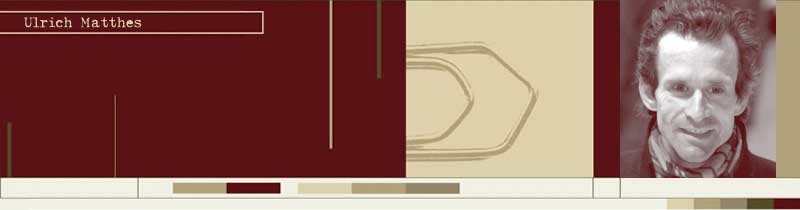
Der Alfred-Kerr-Juror für das Theatertreffen des Jahres 2005 steht nicht nur für die konsequente Verjüngung dieses Ehrenamtes, Ulrich Matthes übernahm die verantwortungsvolle Aufgabe zudem in einem Augenblick höchster öffentlicher Aufmerksamkeit und Anerkennung. Für die Rolle des George in Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“, mit der er in Jürgen Goschs Berliner DT-Inszenierung selbst beim Theatertreffen zu erleben war, ist der 45-Jährige jüngst mit dem renommierten Gertrud-Eysoldt-Ring geehrt worden.
Und parallel zu diesem Bühnen-Erfolg sorgte Matthes auch in Kinofilmen von Oliver Hirschbiegel und Volker Schlöndorff für Furore: Nachdem er im Bunker-Epos „Der Untergang“ die beängstigende Figur des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels verkörpert hatte, setzte er in der Rolle eines im Konzentrationslager Dachau eingekerkerten Geistlichen in „Der neunte Tag“ einen berührenden Kontrapunkt.
2005, im Jahr seiner Tätigkeit als Juror für den Alfred-Kerr-Preis, wurde Ulrich Matthes in der Kritiker-Umfrage der Zeitschrift „Theater heute“ zum Schauspieler des Jahres gewählt. Zur Schauspielerin des Jahres wählten die Kritiker Wiebke Puls,
der Ulrich Matthes den Alfred-Kerr-Preis zugesprochen hatte.
Diese Summe des Erfolgs ist der vorläufige Höhepunkt einer Laufbahn, die der Sohn eines langjährigen „Tagesspiegel“-Chefredakteurs nach Studienanfängen in Germanistik und Anglistik eingeschlagen hatte. Bereits sein Debüt in Kohouts „Armer Mörder“ am Renaissance-Theater meisterte Ulrich Matthes an der Seite von Maximilian Schell, nach zwei Jahren in Krefeld/Mönchengladbach wechselte er 1985 an das Düsseldorfer Schauspielhaus. Hier spielte er unter der Intendanz von Günther Beelitz in nur zwölf Monaten vier Hauptrollen, wobei besonders die Titelpartien in Tankred Dorsts „Heinrich oder Die Schmerzen der Phantasie“ sowie in Joshua Sobols „Weiningers Nacht“ für Furore sorgten. Kurz nach seinem Wechsel an das Bayerische Staatsschauspiel wurde Matthes – mit gerade 31 Jahren – erstmals zum „Schauspieler des Jahres“ gekürt, wenig später fand er in den Münchner Kammerspielen eine neue künstlerische Heimat und feierte als Peter Handkes „Kaspar“ erneut Triumphe. 1992 kehrte er in seine Heimatstadt zurück, um an der Schaubühne große Rollen in Gorkis „Nachtasyl“, in Tschechows „Die Möwe“ sowie im „Orestes“ des Euripides zu übernehmen.
Parallel zu dieser Theater-Karriere ging Ulrich Matthes, an dem Kritiker „die Versinnlichung des Denkens“ loben, auch mit Lesungen – etwa aus Thomas Bernhards „Wittgensteins Neffe“ – auf Tournee und spielte in Filmen wie dem TV-Mehrteiler „Nikolaikirche“ nach dem Roman von Erich Loest und in Tom Tykwers Kino-Melodram „Winterschläfer“. Für die Rolle des Sinclair in Nina Grosses Hölderlin-Porträt „Feuerreiter“ wurde er mit dem Bayerischen Filmpreis geehrt, im Fernsehen war er hernach unter anderem in den zeitgeschichtlichen Filmen „Abgehauen“ und „Todesspiel“ zu sehen.
Dass sich Ulrich Matthes auch dem Schauspieler-Nachwuchs verpflichtet fühlt, zeigte er – nach seinem Darmstädter Regie-Debüt mit „Groß und Klein“ – im Jahr 2003, als er mit Studenten der Berliner Schauspielschule „Ernst Busch“ das Wedekind-Stück „Frühlings Erwachen“ inszenierte. Ein feinnerviger, charakterstarker und wandlungsfähiger Künstler, der die extremen Mühen wie den schönen Lohn seines Berufs aus eigenem Erleben kennt – beste Voraussetzungen für einen Juror des Alfred-Kerr-
Die Preisverleihung fand im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2004 ist:
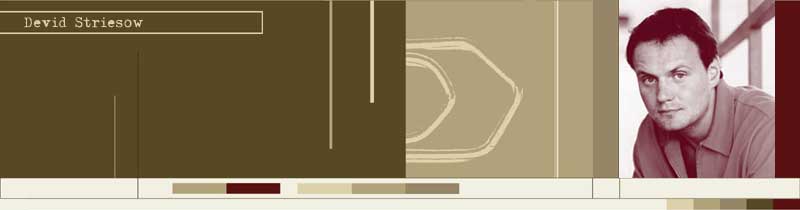
Er erhielt den Preis für die Rolle des Wlas in „Sommergäste“ (Maxim Gorki ) in der Regie von Jürgen Gosch am Schauspielhaus Düsseldorf.
Jahrgang 1973, Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin, Schauspieler in Berlin, Hamburg, Düsseldorf.
Prägende Rollen (Auswahl):
Werner („Minna von Barnhelm“, Lessing), Jonny Flint („Happy End“, Brecht/Weill), Reporter/Künstler („Jeff Koons“, Rainald Goetz), Friedrich Wetter vom Strahl („Das Käthchen von Heilbronn“, Kleist), Hamlet („Hamlet“, Shakespeare)
Zahlreiche Film- und Fernsehrollen, u. a. in „Kalt ist der Abendhauch“ (Regie: Rainer Kaufmann), „Was tun, wenns brennt?“
(Regie: Gregor Schnitzler), „Lichter“ (Regie: Hans-Christian Schmid), „Marseille“ (Regie: Angela Schanelec).
Es gibt sie in jeder Generation und immer findet eine besondere Berührung statt. Machen sie einem doch auf so wunderbare Weise wieder lebendig, warum Theater etwas so Besonderes, so Einzigartiges ist. Das sind die Schauspieler mit dem inneren Leuchten. Ein Leuchten, das den Körper nicht als Begrenzung kennt, sondern als Ausgangspunkt, mich zu erreichen. Das ist mehr, als die Mittel zu kennen und zu nutzen, mehr als kluge Gedanken in sich zu versammeln und über sich hinauszusehen. Vielleicht ist es ein Fieber. Ein Fiebersturm, der entsteht, wenn Wollen und Können Hochzeit machen.
Ich habe einen jungen Schauspieler gesehen, der zart wie die frühe Liebe sein kann, grob wie die Axt im Walde, bitter und böse, verletzt und enttäuscht, verzweifelt und sogar von sich selbst verlassen. Und er hat es mir nie vorgespielt, mich nie darauf aufmerksam machen wollen. Aus sich heraus in die Welt. Ganz einfach, ganz wahr.
Dass er den Löwen auch noch spielen wollte, als Dienstmädchen und Laienschauspieler, hat ihn mir nicht suspekt gemacht.
Im Gegenteil! Es passierte nämlich etwas Außerordentliches. Das Dienstmädchen und der Laienschauspieler waren Facette seiner selbst als Wlas. Er nutzte die inszenatorische Notwendigkeit als Möglichkeit, den Bogen weiter zu spannen. Varianten einer Existenz auszudeuten, ohne am Rollenrand brav stehen zu bleiben. Den ganzen Rahmen des Abends auszuschreiten und mich so auch als Zuschauer ernst zu nehmen, weite Wege mitzugehen.
Ulrich Mühe / Berlin im Mai 2004
Juror war in diesem Jahr der Schauspieler Ulrich Mühe.

Als Ulrich Mühe im Jahr 2004 das Berliner Theatertreffen beobachtete, um einen Preisträger für den Alfred-Kerr-Darstellerpreis auszuwählen, war ihm der Schauplatz bestens vertraut: Wenige Monate zuvor hatte er im Haus der Berliner Festspiele mit prominenter Besetzung Heiner Müllers „Der Auftrag“ inszeniert und damit ein Versprechen eingelöst, das er dem Dramatiker kurz vor dessen Tod gegeben hatte.
Mühes eigentliche Profession freilich ist die des Schauspielers, die der am 20. Juni 1953 im sächsischen Grimma geborene Künstler von 1975 bis 1979 an der Leipziger Hochschule „Hans Otto“ erlernte. Bereits während des Studiums für kleinere Rollen am Städtischen Schauspielhaus Karl-Marx-Stadt verpflichtet, fand er dort sein erstes Engagement und wurde 1982 von Heiner Müller für dessen „Macbeth“-Inszenierung an die Volksbühne geholt. Damit begann die steile Berliner Karriere des Künstlers, die bis heute andauert und über Rollen wie Osvald Alving in Ibsens „Gespenster“ am Deutschen Theater (Regie: Thomas Langhoff), Goethes „Egmont“, Lessings „Philotas“ oder Settiner in Heiner Müllers „Der Lohndrücker“ zu einem Fanal in der Wendezeit führte: Im Doppelprojekt „Hamlet/Hamletmaschine“ wurde der Hauptdarsteller für jene intellektuelle Distanz und emotionale Nähe gefeiert, die den Schauspieler Mühe seit jeher auszeichnet.
Mit dem Fall der Mauer öffneten sich Mühe auch die Bühnen der Salzburger Festspiele (Alfonso in Grillparzers „Jüdin von Toledo“, Regie Thomas Langhoff) und des Wiener Burgtheaters (Goethes „Clavigo“, Ibsens „Peer Gynt“, Regie Claus Peymann) sowie die Film- und Fernsehstudios der wieder vereinten Republik. Nachdem er bereits zu DDR-Zeiten die Hauptrolle in Bernhard Wickis „Das Spinnennetz“ gespielt hatte, übernahm er in Helmut Dietls Satire „Schtonk“ die Rolle des Verlegers.
In „Bennys Video“ sah man ihn an der Seite von Angela Winkler, in „Funny Games“ spielte er gemeinsam mit Susanne Lothar und in „Peanuts – Die Bank zahlt alles“ arbeitete er unter der Regie von Carlo Rola. Mit der Rolle eines Gerichtsmediziners in der Fernsehserie „Der letzte Zeuge“ wurde ihm zudem eine Figur auf den Leib geschrieben, die er sich gemeinsam mit seinem langjährigen Berliner Kollegen Jörg Gudzuhn zu eigen machte.
Auf der Suche nach einem würdigen Gewinner des Alfred-Kerr-Darstellerpreises wurde Ulrich Mühe in Jürgen Goschs Inszenierung der „Sommergäste“ am Düsseldorfer Schauspielhaus fündig: Der junge Darsteller Devid Striesow, der wie der Juror selbst eine parallele Karriere am Theater sowie im Film verfolgt, überzeugte ihn in der Rolle des Wlas durch seine Vielseitigkeit: „Aus sich heraus in die Welt. Ganz einfach, einfach wahr.“
Die Preisverleihung fand im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2003 ist:
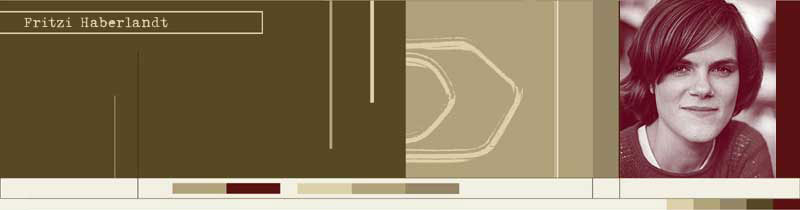
Sie erhielt den Preis für die Rolle der Mizi Schlager in „Liebelei“ (Arthur Schnitzler, Thalia Theater Hamburg, Regie: Michael Thalheimer) und für die Rolle der Adriana in „zeit zu lieben zeit zu sterben“ (Fritz Kater, Thalia Theater Hamburg, Regie Armin Petras).
Jahrgang 1975. Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin. Schauspielerin in Hannover, Hamburg (Thalia Theater), Mitwirkende in Inszenierungen von Robert Wilson in Berlin und New York.
Prägende Rollen (Auswahl):
Franziska (Lessing), Natascha (Gorki), Luise Miller (Schiller), Mizi Schlager (Arthur Schnitzler),
Adriana (Fritz Kater), Marie (Büchner), Julie (Molnár), Lulu (Wedekind), Rollen in Filmen.
Über Fritzi Haberlandt:
Als Mizi Schlager in „Liebelei“ (Arthur Schnitzler) Thalia Theater Hamburg, Regie: Michael Thalheimer
Fritzi Haberlandt lässt ihre Mizi dagegen gar nicht erst sentimental werden. Männer? Sind nichts wert, aber solange man Spaß mit ihnen hat, ist’s okay. Sie macht sich lustig über all das Getue, schwatzt, gestikuliert pantomimisch so viel wie „schön blöd“ oder „wenn die wüsste“. Sie ist die Göre, die kein Pathos kennt und die sich da am wohlsten fühlt, wo es ihr gut geht.
Armgard Seegers, Hamburger Abendblatt, 2. 12. 2002
Als Lulu in „Lulu“ (Frank Wedekind) Thalia Theater Hamburg, Regie: Michael Thalheimer
Fritzi Haberlandt. Immer im kurzen Kleid, mit Strümpfen und Pumps. Schmerzhaft schmal, wie eine Balletttänzerin.
Mit ihren Katzenaugen, ihrem Kindermund und dem kräftigen Kinn, in dem ihre unglaubliche Energie zu stecken scheint.
Sie wechselt die Körperhaltung wie ein Chamäleon die Farbe. Eine Projektionsfläche für Männer und für Frauen.
Rüdiger Schaper, Der Tagesspiegel, 2. 3. 2004
In dem Porträt „Die Präzisionsspielerin“
Der Reiz, Wedekinds flirrende Kindfrau in sich selbst zu finden, treibt die Schauspielerin an: „Die Lulu ist nicht greifbar, die ist alles und nichts. Man liest das, und ist erst mal ratlos. Aber ich glaube, das ist auch eine Frau, die ganz bei sich ist. Und eine Figur, die mich so besitzt, dass ich die ganze Zeit drüber reden muss.“ (…) Die expressive Körperlichkeit, die den Körper gleichzeitig zum Zeichen reduziert, kommt Haberlandt entgegen. Der biegsame, schlenkerige Körper scheint alles mitzumachen, was seine Bewohnerin oder der Regisseur ihm auferlegen.
Ruth Benders in die deutsche bühne, März 2004
Juror war in diesem Jahr Ivan Nagel.
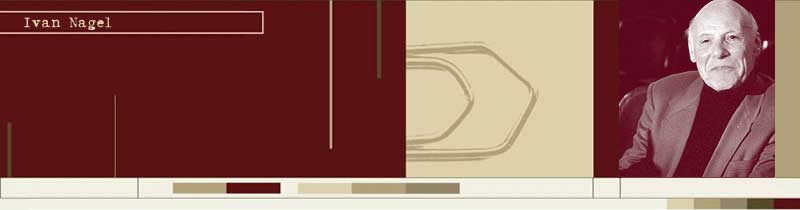
Mit Ivan Nagel wurde im Jahr 2003 erstmals ein Juror für den Alfred-Kerr-Darstellerpreis berufen, der die deutsche Theaterlandschaft vor allem durch sein kritisches und kulturpolitisches Engagement entscheidend geprägt hat. Am 28. Juni 1931 in Budapest geboren, erlitt der Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten in seiner Jugend das Schicksal doppelter Verfolgung:
Nachdem sich die Familie 1944 vor den Nationalsozialisten in Sicherheit hatte bringen können, musste sie vier Jahre später vor dem kommunistischen Regime in die Schweiz fliehen.
Ivan Nagel studierte nach seinem Abitur Germanistik und Soziologie in Paris und Heidelberg, bis er 1955 – zwei Jahre nach seiner Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes, der er als erster Staatenloser angehörte – als „unerwünschter Asylant“ abgeschoben werden sollte. Eine Intervention seiner Lehrer Carlo Schmid und Theodor W. Adorno verhinderte dieses Unrecht, drei Jahre später nahm Nagel die deutsche Staatsbürgerschaft an und begann als Theaterkritiker für die „Deutsche Zeitung“ zu arbeiten. 1962 holte ihn Hans Schweikart an die Münchner Kammerspiele, wo der junge Chefdramaturg auch unter dem folgenden Intendanten August Everding durch die Zusammenarbeit mit Fritz Kortner und durch die Verpflichtung von Peter Stein für Aufsehen sorgte. Nach einem zweijährigen Intermezzo bei der „Süddeutschen Zeitung“ übernahm Nagel 1972 selbst eine Bühne: Für sieben Jahre wurde ihm mit dem Hamburger Schauspielhaus das größte deutsche Sprechtheater anvertraut, das sich zu diesem Zeitpunkt in einer tiefen Krise befand und in drei Jahren sechs Intendanten verschlissen hatte.
Der neue Hausherr gab Ensemble und Spielplan deutliche Konturen: Er verpflichtete Darsteller wie Barbara Sukowa, Hans Michael Rehberg, Will Quadflieg und Ulrich Wildgruber und engagierte Regisseure wie Luc Bondy, Rudolf Noelte, Claus Peymann, Jérôme Savary und Giorgio Strehler. Mit diesen Protagonisten wurden Uraufführungen von Autoren wie Franz Xaver Kroetz oder Botho Strauß in Szene gesetzt, aber auch Aufsehen erregende Klassiker präsentiert – wobei sich ab 1975 vor allem Peter Zadek als dauerhafter Partner etablierte. Dass Nagels Kurs immer wieder in das Kreuzfeuer der Kritik geriet, weil er vielen konservativen Kreisen zu „links“ war, führte 1978 zu seiner Bitte um vorzeitige Vertragsauflösung. Zum Abschied veranstaltete der Intendant in Hamburg ein Fest, das Folgen haben sollte: Aus seinem „Theater der Nationen“ ging 1981 das Festival „Theater der Welt“ hervor, dessen Gründungs-Direktor Nagel wurde.
Nach einer erneuten Interims-Zeit als Kulturkorrespondent der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in New York und einem Forschungsjahr im Berliner Wissenschaftskolleg, dem sich das Buch „Autonomie und Gnade. Über Mozarts Opern“ verdankt, wurde der als Theoretiker wie Praktiker erfahrene Nagel 1985 zum Leiter des Württembergischen Staatsschauspiels Stuttgart berufen – und bewies mit der Verpflichtung der Schauspielerinnen Anne Bennent, Ute Lemper und Susanne Lothar sowie der Regisseure Niels-Peter Rudolph und Jossi Wieler erneut sein Gespür für besondere Begabungen. Dass er sich nach drei Jahren dennoch entschied, die neu geschaffene Professur für Ästhetik und Geschichte der Darstellenden Künste an der Hochschule der Künste in Berlin anzunehmen, war wohl auch dem damit verbundenen Forschungsauftrag zur Französischen Revolution und der Bildenden Kunst geschuldet.
Nach der Wende bewährte sich Ivan Nagel in einer kulturpolitisch heiklen Mission, als er vom Berliner Senat zum Theater-Gutachter bestellt wurde und u. a. die Intendanzen von Frank Castorf in der Volksbühne sowie von Heiner Müller und Peter Zadek am Berliner Ensemble durchsetzte. Aus den dabei gesammelten Erfahrungen resultierte auch die Gründung des „Rates für die Künste in Berlin“, die Nagel 1994 initiierte. Vier Jahre später übernahm er die Schauspiel-Direktion der Salzburger Festspiele, die er aber nach nur einer Saison aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.
Ivan Nagel, dessen essayistische Interessen Literatur, Theater und Musik gleichermaßen umfassen und der neben Texten über prägende Regisseure des Welttheaters oder über „Goyas nackte und bekleidete Maya“ auch politische Streitschriften publiziert hat, ist für seine Arbeiten vielfach geehrt worden. Als er im Jahr 2003 als Juror gebeten war, den Alfred-Kerr-Darstellerpreis zu vergeben, trafen sich sein Interesse an avancierten Regie-Handschriften und unverwechselbarem Schauspieler-Charakter in einer Person: Er zeichnete Fritzi Haberlandt für ihre Rollen in Arthur Schnitzlers „Liebelei“ (Regie: Michael Thalheimer) und in Fritz Katers „zeit zu lieben zeit zu sterben“ (Regie: Armin Petras) am Thalia-Theater Hamburg aus.
Die Preisverleihung fand im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2002 ist:
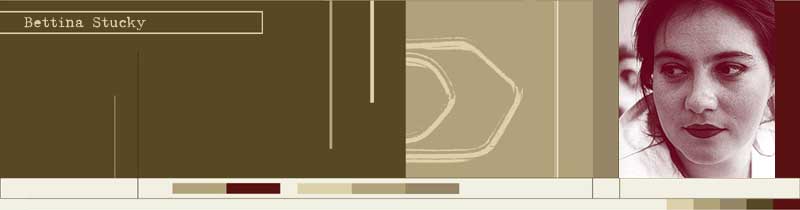
Sie erhielt den Preis für die Rolle der Natalja in „Drei Schwestern“ (Anton Tschechow, Schauspielhaus Zürich, Regie: Stefan Pucher) und die Rolle im Ensemble von „Die schöne Müllerin“ (Wilhelm Müller/Franz Schubert, Schauspielhaus Zürich, Regie: Christoph Marthaler).
Jahrgang 1969. Ausbildung an der Berner Schauspielschule. Schauspielerin in Berlin, Kassel, Jena, Wuppertal, Basel, Berlin, Zürich.
Prägende Rollen (Auswahl):
Warja, Natalja (Tschechow), Protagonistin in Marthaler-Inszenierungen: „Hotel Angst“, „Synchron“, „Das goldene Zeitalter“.
Über Bettina Stucky:
Als Natalja in „Drei Schwestern“ (Anton Tschechow) Schauspielhaus Zürich, Regie: Stefan Pucher
Sie ist die unschuldige Naive im Blümchenkleid als Natalja in Puchers „Drei Schwestern“, mit dieser naturbelassenen Süße im Gesicht, diesem sogenannten Schmelz, der in Schwarzweißfilmen so wunderbar mit winzigen Lichteffekten betont werden konnte. Sie muss sich mit ihrer ganzen Leibeskraft und –präsenz durch die sperrigen Türen zwängen, mit denen sich die sieche, feine Philosophiergesellschaft von eher am Überleben als am Untergehen interessierten Geschöpfen, wie Natalja eines ist, abgeschottet hat. Doch spätestens als sie mit ihrem unbrauchbaren, teiggesichtigen Andrej zu einem schnulzigen Liebesmusical anhebt, so unfassbar lieblich, rein, rundum gottgefällig und gesund, dass es einfach nicht wahr sein kann, beginnt man Monströses zu ahnen. Und siehe da, das Biest entfaltet sich allmählich, wird zur geschmacklosen, dafür umso selbstbewusster in Satin und Perlen gepackten Kurvenschönheit, zur veritablen Bitch der maroden Gutsbesitzerszene, egoistisch, raffgierig, sexy…
Simone Meier in „Theater heute“, Juni 2002
Als Darstellerin in „Die schöne Müllerin“ (Wilhelm Müller/Franz Schubert) Schauspielhaus Zürich,
Regie: Christoph Marthaler
Sehnsucht war das Motto hinter all Ihren Aktionen, aber Lyrismen haben Sie sich nicht gestattet. Hätten die Marx-Brothers Schwestern, Sie wären an diesem Abend eine gewesen…
Aus der Laudatio von Elisabeth Trissenaar zur Verleihung des Alfred-Kerr-Darstellerpreises
Jurorin war in diesem Jahr Elisabeth Trissenaar.
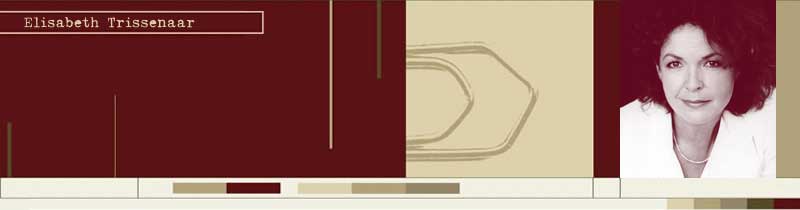
Die Jurorin des Jahres 2002 hatte ihre Karriere einst dort begonnen, wo die von ihr gewählte Preisträgerin Jahre später ihre Kunst erlernte: Elisabeth Trissenaar, am 13. April 1944 in Wien geboren, spielte nach dem Studium am Max-Reinhardt-Institut 1964 im Ensemble des Stadttheaters Bern erste große Rollen wie das Gretchen in Goethes „Faust“ und die Thekla in Schillers „Wallenstein“, ehe sie mit ihrem Lebens- und Arbeitspartner Hans Neuenfels nach Deutschland kam. Krefeld, Heidelberg, Bochum und Stuttgart hießen die ersten Stationen ihrer langen gemeinsamen Reise, an denen sich die Darstellerin u.a. Figuren wie Strindbergs Fräulein Julie und die Wanja aus Tschechows „Kirschgarten“ zu eigen machte.
Bereits in jenen Jahren von Kritikern wie Friedrich Luft als „große Tragödin“ gefeiert, prägte Elisabeth Trissenaar von 1972 bis 1978 auch die Neuenfels-Ära im Schauspiel Frankfurt, wo sie u. a. als Hedda Gabler und Medea Triumphe feierte.
In diese Jahre fällt auch der Beginn ihrer Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder, der sie in seinen Filmen „Bolwieser“,
„Die Ehe der Maria Braun“, „In einem Jahr mit 13 Monden“ und in der Verfilmung von Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ besetzte. Mit diesen Klassikern unter den bundesdeutschen Kino- und Fernsehfilmen empfahl sie sich zugleich für spätere Hauptrollen in Robert van Ackerens „Das andere Lächeln“ und „Die Reinheit des Herzens“ sowie in dem oscar-nominierten Film „Bittere Ernte“ und in Xaver Schwarzenbergers „Franza“.
Obwohl Elisabeth Trissenaar auch auf der Bühne zunehmend mit anderen prominenten Regisseuren wie Jürgen Flimm
(„Das Käthchen von Heilbronn“, Schauspielhaus Zürich), Peter Palitzsch („Liebe und Magie in Mammas Küche“, Freie Volksbühne Berlin) oder Ruth Berghaus („Die Braut von Messina“, ebd.) zusammenarbeitete, blieb sie ästhetisch und biografisch doch in den Inszenierungen von Hans Neuenfels verwurzelt. Mit ihm erschloss sie sich nicht nur ein umfangreiches Material von Goethes „Iphigenie auf Tauris“ bis zu Musils „Die Schwärmer“, von Genets „Die Zofen“ bis zu Kleists „Penthesilea“. Die zuletzt genannte Rolle bildete zudem den Anlass für den Film „Heinrich Penthesilea von Kleist“, der seine Uraufführung auf der Berlinale 1983 feierte.
Nachdem die als „Gemütserregungskünstlerin“ gefeierte Elisabeth Trissenaar im Jahr 2000 bereits mit zwei Anwärtern auf den Alfred-Kerr-Darstellerpreis gearbeitet hatte, als sie mit August Diehl und Fritzi Haberlandt in der Verfilmung von Ingrid Nolls Roman „Kalt ist der Abendhauch“ spielte, amtierte sie genau zwischen diesen beiden Gewinnern der Jahre 2001 und 2003 als Jurorin. Ihre Wahl fiel auf Bettina Stucky, die sie für ihre Zürcher Rollen als Natalja in Tschechows „Drei Schwestern“
(Regie: Stefan Pucher) und in „Die schöne Müllerin” (Regie: Christoph Marthaler) auswählte.
Die Preisverleihung fand im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2001 ist:

Er erhielt den Preis für die Rolle des Konstantin Gawrilowitsch Trepljow in „Die Möwe“ (Anton Tschechow, Burgtheater Wien, Regie: Luc Bondy).
Jahrgang 1976. Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin, Schauspieler in Hamburg, Berlin, Dortmund, Wien.
Prägende Rollen (Auswahl):
Kostja (Tschechow), Polyneikes (Sophokles), Sigismund (Calderon), Robin (Sarah Kane), Roberto Zucco (Koltès),
Don Karlos (Schiller). Zahlreiche Rollen in Filmen (unter anderem: “Kalt ist der Abendhauch“ mit Fritzi Haberlandt).
Über August Diehl:
Als Konstantin Gawrilowitsch Trepljow in „Die Möwe“ (Anton Tschechow) Burgtheater Wien, Regie: Luc Bondy
…man ist bekehrt, bezaubert, und weiß, das ist Theater, wie es tiefer, bewegender nicht sein kann. Und alles geht uns an, was sie denken, was sie tun, da auf der Bühne, die Arkadina ebenso wie Konstantin, und alles ist von heute. Theaterglück. Konstantin, wie er vor Eifer glühend den erhabenen Unsinn seines Stücks mitspricht…
Ulrike Kahle, Magazin Theatertreffen Berlin 2001
Als Don Karlos in „Don Karlos“ (Friedrich Schiller) Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Regie: Laurent Chétouane
Allerdings wäre Chétouanes Rechnung ohne zwei Ausnahmespieler nicht aufgegangen. August Diehl, der so ausdrucksstarke wie überzeugende Kronprinz Karlos, und Devid Striesows rationaler Posa beherrschen beide die Kunst, Bewegung in die minimalistische Statik des Spiels zu bringen durch die Verfertigung von Gedanken beim Reden und durch Gefühlstöne jenseits von hohlem Pathos.
Klaus Witzeling, Hamburger Abendblatt, 8. 3. 2004
Aus einem Interview über die Rolle des Jeff in dem Film „Love The Hand Way“:
Jeff ist eine Rolle, die offen anfängt und offen aufhört. Seine Person wird nicht groß eingeführt. Entweder der Zuschauer akzeptiert sie oder nicht. Das war gerade das Reizvolle für mich. Wenn man große Rollen hat, dann kann man zwar sehr stark darstellen, aber es besteht die Gefahr, dass die Figur an Geheimnis verliert. Bei Hauptrollen kontrolliere ich mich ständig selber und frage mich: agierst du noch natürlich, lässt du der Figur ihr Geheimnis? Mit Jeff konnte ich mich ausleben, weil ich wusste, es sind vier, fünf Szenen, die können ruhig extrem sein und fast ins Künstliche gehen.
Dirk Jasper, FilmstartLexikon, 2003
Juror war in diesem Jahr Walter Schmidinger.
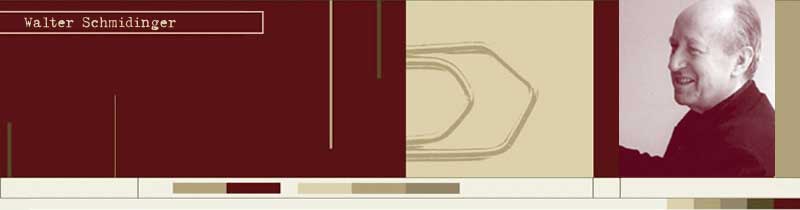
Mit Walter Schmidinger hielt am Beginn des neuen Jahrtausends ein Novum in der Geschichte des Alfred-Kerr-Darstellerpreises Einzug: Der Juror fand seinen Preisträger in einer Inszenierung des Wiener Burgtheaters, in der er ursprünglich selbst mitwirken sollte. Der Weg in dieses Ensemble der Olympier aber hatte den gebürtigen Österreicher Schmidinger über Deutschland geführt:
Am 28. April 1933 in der Donau-Stadt Linz geboren, begeisterte sich der Junge früh für das Theater– und musste doch eine Lehre als Dekorateur und Verkäufer absolvieren, ehe er sich am Max-Reinhardt-Institut in Wien zum Schauspieler ausbilden lassen konnte. Nach seinem Debüt im Theater an der Josefstadt kam er 1954 über Bonn nach Düsseldorf, wo er für sechs Jahre eine erste künstlerische Heimat fand.
In den Jahren 1960 bis 1969 gehörte er erneut zum Bonner, danach für drei Jahre zum Münchner Kammerspiel-Ensemble – und wechselte dann für 13 Jahre an das Bayerische Staatsschauspiel, wo er u. a. als Shylock in Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ umjubelt wurde. Die Leidenschaft des Künstlers, den ein Kritiker einmal als „Mann des entschiedenen Einerseits-Andererseits“ charakterisierte, galt jedoch komisch-weinerlichen und ironisch-gebrochenen Charakteren. So sammelte er Erfolge als Petypon in Feydeaus „Einen Jux will er sich machen“ oder als Herr Lips in Nestroys „Der Zerrissene“, aber auch als Malvolio in Shakespeares „Was ihr wollt“ oder als Salieri in Shaffers „Amadeus“.
Mitte der 80er Jahre folgte Walter Schmidinger einem Ruf an das Berliner Schiller-Theater, wo er in den Titelrollen von Lessings „Nathan der Weise“ und Hofmannsthals „Der Unbestechliche“ ebenso triumphierte wie in den Shakespeare-Inszenierungen „König Lear“ und „König Richard II.“ – und 1989 die Rolle des Richard in der Uraufführung von Thomas Bernhards „Elisabeth II.“ kreierte. Ehe er mit dem gesamten Ensemble die Kündigung wegen der Schließung des Schiller-Theaters erhielt, spielte er unter der Regie von Alexander Lang noch „den eingebildetsten Kranken aller Zeiten“ – und wechselte danach an das Deutsche Theater im Ost-Teil der Stadt.
Seine späte Heimkehr an das Burgtheater feierte Walter Schmidinger ein Jahr vor seiner Juroren-Tätigkeit für den Alfred-Kerr-Darstellerpreis im Jahr 2000 mit einer Lesung von Texten des Autors Thomas Bernhard, den sein misanthropischer Charakter durchaus als Seelenverwandten des Schauspielers erscheinen lässt. Dass der auch als Regisseur (u. a. Oscar Wildes „Salome“) und Fernsehschauspieler erfolgreiche Künstler darüber hinaus den Berliner Bühnen treu blieb, trug ihm 2003 noch einmal eine Paraderolle ein: Mit Robert Wilson, der ihn bereits 1984 in „Der Mond im Gras“ besetzt hatte, erarbeitete er die Rolle des König Peter in der umjubelten Inszenierung von Büchners „Leonce und Lena“ am Berliner Ensemble.
Für den Alfred-Kerr-Darstellerpreis aber wählte Walter Schmidinger den jungen Schauspieler August Diehl, der die Rolle des Konstantin Gawrilowitsch Trepljow in Tschechows „Die Möwe“ am Burgtheater Wien verkörperte – eine Inszenierung von Luc Bondy, der zunächst auch Schmidinger hatte besetzen wollen.
Die Preisverleihung fand im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2000 ist:
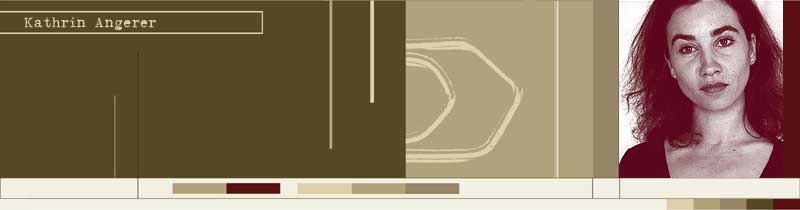
Sie erhielt den Preis für die Rolle der Darja Pawlowna Schatowa in „Dämonen“ (Fjodor Dostojewski, Volksbühne Berlin, Regie Frank Castorf).
Jahrgang 1970. Von 1987 bis 1992 von mehreren Schauspielschulen nach Vorsprechen abgelehnt, Ausbildung beim Theaterverein 1990 Berlin, 1993 erster Gastvertrag bei Frank Castorf an der Volksbühne Berlin, danach festes Engagement an der Volksbühne Berlin.
Wichtige Rollen (Auswahl):
in den Castorf-Inszenierungen von Hauptmanns „Die Weber“, Sartres „Schmutzige Hände“, Shakespeares „Heinrich VI.“,
Castorf/Williams‘ „Endstation Amerika“ und „Forever Young“, Dostojewskis „Erniedrigte und Beleidigte“ und „Dämonen“,
Bulgakows „Der Meister und Margarita“
Zahlreiche Rollen in Filmen, Hörbücher, musikalische Interpretationen.
Über Kathrin Angerer:
Als Alexandra del Lago in „Forever Young“ (Frank Castorf nach Tennessee Williams) Volksbühne Berlin,
Regie: Frank Castorf
Auch Lolitas altern. Zwar sehen sie dann immer noch nicht wie Norma Desmond aus und auch nicht unbedingt wie Tennessee Williams alternde Diva Alexandra del Lago in diesem leicht verblichenen Südstaatendrama von 1959. Aber schließlich heißt der Abend, von dem die Rede ist, auch gar nicht „Süßer Vogel Jugend“, sondern handelt nur davon. Auf der Bühne wird Castorf-like „frei nach“ gespielt. Nur dass die alternde Filmdiva im vorliegenden Fall wie Kathrin Angerer aussieht, die irrlichternde Kindfrau unzähliger Castorf-Inszenierungen, macht Sinn. Natürlich ist sie viel zu jung. Trotzdem sieht das Alter in ihrem jungen Gesicht bedrohlich aus. Vielleicht auch, weil man den Vogel Jugend im Augenblick seines Davonfliegens beobachten kann.
Esther Slevogt. taz Berlin, 2003
Als Mitglied im Ensemble bei „Dämonen“ (Fjodor Dostojewski) Volksbühne Berlin, Regie: Frank Castorf
Diese unwiderstehlichen Castorfschen Schauspieler, die ganz sie selbst sind und sich gelegentlich auch mal elegant ihre Rolle überwerfen. Vertraute Menschen. Sie sind ratlos und unglücklich, wandeln auch mal über Wasser, plumpsen ausgiebig allein oder zu zweit in ein überraschend tiefes Wasserloch im flachen Pool, sie begehren sich, hassen sich und reden und reden.
Ulrike Kahle, Magazin zum Berliner Theatertreffen, 2000
Juror war in diesem Jahr Udo Samel.

Im Jahr 2000 übernahm mit Udo Samel ein Künstler die Juroren-Aufgabe für den Alfred-Kerr-Darstellerpreis, der auch als Regisseur im Musiktheater Erfolge gefeiert hat. Am 25. Juni 1953 in Eitelsbach bei Trier geboren, erhielt Udo Samel während seiner zehnjährigen Internats-Zeit bis 1973 zunächst eine umfangreiche musikalische Ausbildung und begann ein Studium der Slawistik und Philosophie, ehe er sich an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main zum Schauspieler ausbilden ließ. Bereits während dieser Zeit debütierte er am Staatstheater Darmstadt in Marie-Luise Fleißers „Fegefeuer in Ingolstadt“. Nach einem zweijährigen Engagement in Düsseldorf, wo er unter anderem die Titelrolle in Hanns Henny Jahns „Thomas Chatterton“ gespielt hatte, kam Samel 1978 an die Berliner Schaubühne. Ihrem Ensemble gehörte er bis 1992 an.
In diesen Jahren, die der Schauspieler rückblickend als seine „wichtigste Zeit am Theater“ beschrieb, begann auch seine Karriere als Kino- und Fernseh-Darsteller. Nach „Messer im Kopf“ (Regie: Reinhard Hauff, 1978) war es vor allem die Rolle des Franz Schubert im ZDF-Dreiteiler „Mit meinen heißen Tränen“ (Regie: Fritz Lehner, 1986), die Udo Samel unumstrittenes Lob eintrug. Weitere Höhepunkte seiner Filmarbeit waren „Der Vulkan“ nach Klaus Mann und Hans-Christoph Blumenbergs
„Das Deutschlandspiel“, in dem er als Michail Gorbatschow zu sehen war. Im Jahr 2001 wirkte er in Michael Hanekes Verfilmung von Elfriede Jelineks „Die Klavierspielerin“ mit.
Während seiner Zeit an der Schaubühne prägte Samel vor allem Stücke von Botho Strauß („Kalldewey, Farce“, „Die Zeit und das Zimmer“) und Inszenierungen von Peter Stein, Robert Wilson und Klaus Michael Grüber, der ihn 1986 bei den Salzburger Festspielen als Hermes in seiner umjubelten Arbeit „Prometheus, gefesselt“ besetzte. Sieben Jahre später übernahm er am gleichen Ort die Rolle des Teufels in Hofmannsthals „Jedermann“.
Sein Debüt als Opern-Regisseur gab Udo Samel 1996 am Deutschen Nationaltheater Weimar mit Alban Bergs „Wozzeck“, in Dresden folgten wenig später „Aida“ und „Il Trittico“. Nach Schauspiel-Inszenierungen wie der Uraufführung von Albert Ostermaiers „Zuckersüß und Leichenbitter“ (München 1997, auch Hauptrolle) sowie Harry Mulischs „Das Theater, der Brief und die Wahrheit“ (Frankfurt am Main, 2001) kreierte Samel zuletzt 2003 Franz Schuberts Lied-Zyklus „Die schöne Müllerin“ am Schauspiel Frankfurt. Zum 75. Geburtstag von Heiner Müller wirkte er im Januar 2004 als Darsteller in Ulrich Mühes Berliner Inszenierung von „Der Auftrag mit“.
Als Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreises wählte Udo Samel, der selbst u. a. mit dem Europäischen Filmpreis und dem Adolf-Grimme-Preis geehrt wurde, im Jahr 2000 Kathrin Angerer. Er würdigte damit ihre Rolle als Darja Pawlowna Schatowa in Frank Castorfs Inszenierung der „Dämonen“ nach Dostojewski an der Volksbühne Berlin.
Die Preisverleihung fand im Haus der Berliner Festspiele statt.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 1999 ist:
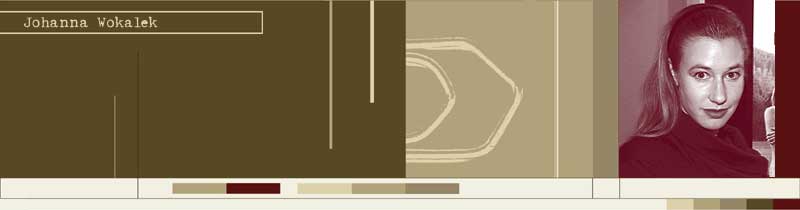
Sie erhielt den Preis für die Titelrolle in „Rose Bernd“ (Gerhart Hauptmann, Schauspiel Bonn, Regie: Valentin Jeker).
Jahrgang 1975. Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Schauspielerin in Bonn, Wien (Burgtheater), Bochum.
Prägende Rollen (Auswahl):
Rose Bernd (Hauptmann), Polly (Brecht), Ophelia (Shakespeare), Nina (Tschechow),
Emilia Galotti (Lessing). Zahlreiche Rollen im Film, Bayrischer Filmpreis 2004 für Lene in „Hierankl“.
Über Johanna Wokalek:
Als Rose Bernd in „Rose Bernd“ (Gerhart Hauptmann) Schauspiel Bonn, Regie: Valentin Jeker
„Rose Bernd“, was ist aus diesem Schmachtfetzen des Naturalismus, aus dieser Bürger-Tragödie von der Liebe zu einem verheirateten Mann, dem unvermeidlichen ledigen Kind und dem schauerlichen Kindesmord heute noch herauszuholen? –
Genug für Johanna Wokalek, um Nachwuchsschauspielerin des Jahres zu werden!
Jahrbuch Theater heute, 1999
Als Emilia Galotti in „Emilia Galotti“ (Gotthold Ephraim Lessing) Burgtheater Wien, Regie: Andrea Breth
Johanna Wokalek als Emilia ist von den Avancen des Prinzen sichtlich tief beeindruckt; wie sie nach der ersten Begegnung voll Angstlust über die Bühne zappelt, ist nicht unwitzig – richtig komisch wird es aber erst, wenn Elisabeth Orth als lebenserfahrene Matrone die Tochter wieder zur Ruhe bringt.
Wolfgang Kralicek, Magazin Berliner Theatertreffen 2003
In einer Ankündigung des TV-Porträts von Johanna Wokalek in der Reihe „Abgeschminkt“
Als „Rose Bernd“ in Gerhart Hauptmanns gleichnamigem Theaterstück begeisterte Johanna Wokalek 1999 das Publikum beim Theatertreffen in Berlin und erhielt sogleich den Alfred-Kerr-Darstellerpreis. In diesem Jahr kommt sie als „Emilia Galotti“ vom Burgtheater Wien zum zweiten Mal zur „Bestenschau“ nach Berlin. Johanna Wokalek kämpft weder um Rollen noch um Einfluss am Theater, sondern versucht, wie sie sagt, „ohne Druck zu arbeiten“. „Theater ist Teamwork, ständige Auseinandersetzung mit Menschen, das ist ein Grund, warum ich diesen Beruf ergriffen habe“, hat sie in einem Interview geäußert.
3sat / ZDF Theaterkanal Mai 2003
Jurorin war in diesem Jahr Angelica Domröse.
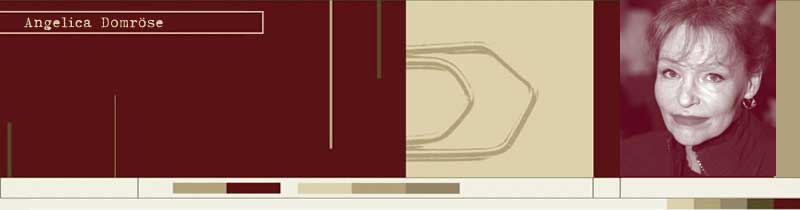
Zehn Jahre nach der Wende konnte eine Jurorin für den Alfred-Kerr-Darstellerpreis gewonnen werden, deren Biografie die Zeitläufte in Ost- und West-Deutschland exemplarisch spiegelt: Angelica Domröse, am 4. April 1941 in Berlin-Weißensee geboren und zunächst als Stenotypistin ausgebildet, sammelte erste professionelle Schauspiel-Erfahrungen bereits vor dem Studium. Nachdem sie an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg abgelehnt worden war, bewarb sie sich um eine Rolle in Slatan Dudows „Verwirrung der Gefühle“. Der Erfolg unter 1 500 Kandidatinnen bescherte ihr schließlich doch noch den ersehnten Studienplatz – und wenig später Parade-Rollen wie die Polly in der „Dreigroschenoper“ am Berliner Ensemble.
1966, parallel zu ihrer Wahl als „Schauspielerin des Jahres“ in der DDR, wechselte Angelica Domröse an die Volksbühne, der sie bis 1979 die Treue hielt. Einem breiten Publikum aber wurde sie vor allem durch ihre mehr als 50 Rollen in Kino- und Fernsehfilmen bekannt, zu denen neben „Julia lebt“, „Chronik eines Mordes“, „Ein Lord am Alexanderplatz“ und „Krupp und Krause“ vor allem ihre prägenden Arbeiten in den Defa-Klassikern „Effi Briest“ (1968/69), „Die Legende von Paul und Paula“ (1972) sowie „Bis dass der Tod euch scheidet“ (1977/78) zu zählen sind.
Obwohl ein ostdeutsches Kino ohne die ebenso zarte wie kraftvoll-energische Künstlerin kaum vorstellbar schien, wurde auch Angelica Domröse nach Unterzeichnung des Protestes gegen Wolf Biermann ab 1976 gemaßregelt – und versuchte 1980 ihr Glück jenseits der deutsch-deutschen Grenze. Nach ihrem Gastspiel am Hamburger Schauspielhaus, wo sie als Helena in Boy Goberts Abschiedsinszenierung „Faust“ zu sehen war, folgte sie diesem Regisseur gemeinsam mit ihrem Mann Hilmar Thate an das Berliner Schiller-Theater – und eroberte sich in Peter Zadeks Fallada-Bearbeitung „Jeder stirbt für sich allein“ sowie in der Titelpartie von Wedekinds „Lulu“ quasi aus dem Stand ein neues Publikum. So zu freischaffender Arbeit ermutigt, sah man Angelica Domröse in den 80er Jahren u. a. in Jérôme Savarys „Bye, bye Show-Biz“ in Stuttgart und in Gaston Salvatores „Stalin“ in Wien, ehe sie zur Wende-Zeit an das Schiller-Theater zurückkehrte. Seit dessen Schließung hat sie wieder verstärkt im Fernsehen gearbeitet, u. a. in Horst Kummeths „Hurenglück“ und als Kommissarin im „Polizeiruf 110“. 1992 debütierte Angelica Domröse mit Matthias Zschockes „Brut“ am Berliner bat-Theater zudem als Regisseurin, seither inszenierte sie u. a. in Meiningen und beim Kurt-Weill-Fest Dessau.
Dass die Domröse als Jurorin des Alfred-Kerr-Preises 1999 eine junge, starke Frau auszeichnete, konnte kaum verwundern: Sie wählte aus den Inszenierungen des Berliner Theatertreffens Johanna Wokalek in der Titelrolle der „Rose Bernd“ von Gerhart Hauptmann am Schauspiel Bonn (Regie: Valentin Jeker).
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 1994 ist:
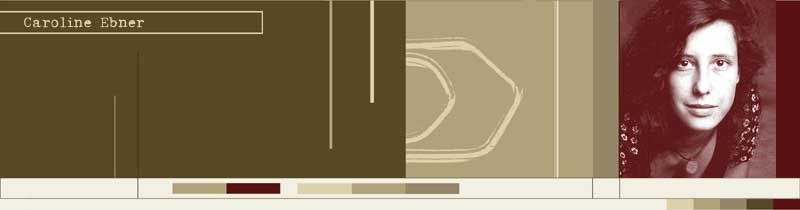
Sie erhielt den Preis für die Rolle der Julia in „Romeo und Julia“ (William Shakespeare, Staatstheater Düsseldorf, Regie Karin Beier).
Jahrgang 1970. Ausbildung an der Folkwang-Schule Essen. Schauspielerin in Bremen, Düsseldorf, Hannover, Hamburg.
Prägende Rollen (Auswahl):
Anna (Gorki, Nachtasyl), Gräfin Werdenfels (Wedekind), Anne Frank. Viele Rollen im Film und im Fernsehen.
Über Caroline Ebner:
Als Julia in „Romeo und Julia“ (William Shakespeare) Staatstheater Düsseldorf, Regie Karin Beier
Während die Jüngeren gerade noch ein bisschen Lüsternheit aufbringen, haben es die Jüngsten schwer, wenn sie die Liebe überfällt. Romeo (Matthias Leja) macht sich gleich mit dem versuchten Cunnilingus an Julia (Caroline Ebner) heran, was diese mit kühler Rhetorik abweist. Beider Triebkräfte haben mit romantischer Innerlichkeit nichts gemein, der Liebe bleibt keine Zeit auf Erden – die Verhältnisse sind einfach nicht so.
Ulrich Schreiber, Magazin zum Theatertreffen Berlin 1994
Als Gräfin Werdenfels in „Der Marquis von Keith“ (Frank Wedekind), Münchner Kammerspiele,
Regie: Peter Kastenmüller
Caroline Ebner als angeheiratete Gräfin Werdenfels, geschminkt wie eine bayrische Geisha, lässt hinter einer dicken Schicht Schminke Luder-Spuren des unverblümten Vorstadtmädels erkennen.
Silvia Stammen, Theater heute, April 2002
Als Anne Frank in „Das Porträt einer Dichterin als junges Mädchen“, Kammerspiele Hamburg, Regie: Ulrich Waller
Anne Frank – die kleine Chronistin des Holocaust, gelesen von Generationen von Schülern. Auch Caroline Ebner hat als Jugendliche mit diesem Mädchen gelitten. Inzwischen ist die Schauspielerin 31 Jahre alt und hat mit Ulrich Waller einen Theaterabend kreiert: „Anne Frank – Das Porträt einer Dichterin als junges Mädchen“. Wie spielt man als 31-Jährige eine
13-Jährige? „Ich versuche, das Junge in mir zu finden“, sagt Caroline Ebner, „Anne Franks Gedanken nachzuvollziehen.“
Es hilft, dass sie das Mädchen mag. Ihre Fantasie und Emotionalität, ihre Tapferkeit und Disziplin. (…) Caroline Ebner stellt die junge Dichterin vor. Die hatte auf die Rückseiten ihres Tagebuchs Prosatexte geschrieben, Fantasiegeschichten, mit denen sie sich aus dem Gefängnis hinausträumte. Von Begegnungen mit Filmstars oder einem Flug nach Amerika, der ganze fünf Tage dauert (…) Humor ist ein wichtiger Aspekt bei Anne Frank, Was bedeutet er der Schauspielerin? „Humor ist ein Grundnahrungsmittel, das wichtigste neben Wasser.”
Susann Oberacker, Morgenpost Hamburg, 1. 2. 2002
Caroline Ebner macht den Abend zu einem fesselnden Theatererlebnis und benötigt dazu wenig mehr als ihre Stimme, leise, vorsichtige Bewegungen und ihre beredte Gestik und Mimik.(…) Verschmitzt, kess, leicht arrogant, widerspenstig, eigenwillig und übermütig ist ihre Anne Frank. Und kann im nächsten Moment in tiefe Verzweiflung und Trostlosigkeit stürzen. Sie ist unsicher und zaghaft und gleich darauf neugierig und selbstbewusst. Caroline Ebner versteht im Alleingang alle Gefühlsmomente dieses außergewöhnlichen Mädchencharakters in sensibler Nuancierung lebendig werden zu lassen.
Birgit Schmalmack für www.hamburgtheater.de 2003
Jurorin war in diesem Jahr Käthe Reichel.
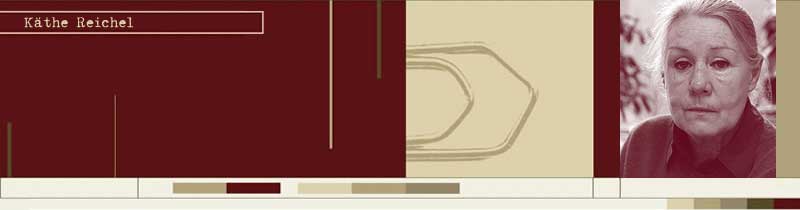
In Käthe Reichel fand die Alfred-Kerr-Stiftung 1994 nicht nur eine Jurorin, die durch ihre künstlerische Kraft ein Vorbild für die junge Schauspieler-Generation darstellt – sondern auch jenen buchstäblichen „guten Menschen“, den sie 1957 überaus erfolgreich verkörperte. 1926 in Berlin geboren, erhielt Käthe Reichel ohne vorherige Ausbildung erste Engagements in Greiz, Gotha und Rostock, ehe sie 1950 von Bertolt Brecht an das Berliner Ensemble verpflichtet wurde. Hier verkörperte sie in mehr als einem Jahrzehnt große Rollen wie Gretchen (Goethe „Urfaust“), Jeanne d‘Arc (Seghers, „Der Prozess der Jeanne d’Arc zu Rouen 1431“) und Natella Abaschwili (Brecht, „Der kaukasische Kreidekreis“). In letztgenanntem Stück spielte sie – gewissermaßen als Brecht-Botschafterin für Westdeutschland – wenig später in Frankfurt am Main auch die Grusche. Dorthin war sie von Benno Besson verpflichtet worden, der sie auch als Shen Te / Shui Ta in „Der gute Mensch von Sezuan“ und als Titelheldin in Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ besetzte. Dass Käthe Reichel damit ihre erklärte Lieblingspartie gefunden hatte, zeigte sich auch in ihrer Konfrontation mit dem klassischen Repertoire: So entdeckte sie 1960 in Lessings „Minna von Barnhelm“ als Ensemble-Mitglied des Deutschen Theater und unter der Regie von Wolfgang Langhoff ein neuartiges, emanzipiertes Frauen-Bild.
Anderthalb Jahrzehnte später spielte sie in Sarah Kirschs Text-Collage „Lebensläufe“ erneut eine Proletarierin, die laut zeitgenössischer Kritiker-Meinung „nirgends auf der Butterseite des Staates zu liegen kam“. Mit diesem Zitat kann man Käthe Reichels Spiel generell beschreiben: Ihre kräftige, sinnliche Auffassung des Berufes, den sie seit Jahrzehnten freischaffend ausübt, ist immer mit politischem und sozialem Engagement im Geiste ihres Lehrmeisters Brecht verknüpft. Das zeigte sich nicht nur in ihrer Rede zur legendären Demonstration 1989 auf dem Alexanderplatz, sondern sechs Jahre später u.a. auch in der Aktion „Mütter, versteckt eure Söhne“, die Käthe Reichel gemeinsam mit Heiner Müller aus Solidarität für die tschetschenischen Soldatenmütter initiierte. Ihre Alfred-Kerr-Preisträgerin hatte die selbst ernannte „Berufsquerulantin“ ein Jahr zuvor in Karin Beiers Shakespeare-Inszenierung „Romeo und Julia“ gefunden: Die Jurorin Käthe Reichel wählte Caroline Ebner für die Darstellung der weiblichen Titelrolle.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 1993 ist:
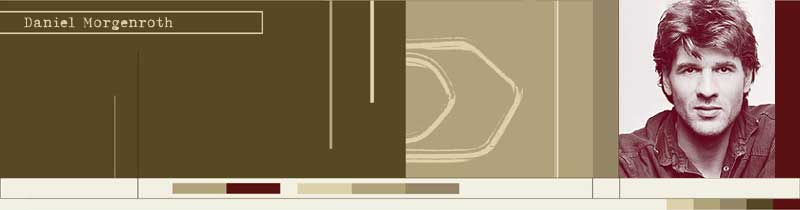
Er erhielt den Preis für die Rolle des Sigismund in „Der Turm“ (Hugo von Hofmannsthal, Deutsches Theater Berlin, Regie: Thomas Langhoff).
Jahrgang 1964. Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin. Schauspieler und Regisseur in Berlin (Deutsches Theater, Theater am Kurfürstendamm, Staatsoper Berlin).
Prägende Rollen (Auswahl)
Tempelherr (Lessing), Peer Gynt (Ibsen), Graf Wetter vom Strahl, Amphitryon (Kleist), Siegfried (Hebbel), Achill (Kleist),
Fabian (Kästner). Regie: Entdeckungen des Vaters bei gemäßigt leichter Gartenarbeit (Apollosaal, Staatsoper Berlin).
Viele Rollen im Film und im Fernsehen, eigene Texte, Zusammenarbeit mit dem Komponisten Christoph Schambach.
Über Daniel Morgenroth
Als Peer Gynt in „Peer Gynt“ (Henrik Ibsen), Deutsches Theater Berlin, Regie: Friedo Solter
Ein Schauspieler ist der Magier, der allen Zauber liefert, die Bilder entstehen lässt und sich selbst als den Schöpfer einer eigenen, faszinierenden Welt begreift: Daniel Morgenroth als Peer Gynt. Der Naturbursche des Beginns hat eine unbändige Heiterkeit, eine den Körper durchrüttelnde Kraft, eine Wildheit, die Zärtliches verbirgt, etwa im jungenhaft derben, herzlichen Umgang mit der Mutter.
Christoph Funke, Der Morgen, 06.05.1991
Die Inszenierung baut auf die Stufenleiter vom Jedermann zum Niemand. Erst Kraftprotz, dann Bürgerschreck und Adoptivsohn der Trolle, später Nabob und Selfmademan, und am Ende Strandgut, sich selber so fremd, als habe es ihn nie gegeben, ein erschöpftes Exemplar mit dem Tod im Nacken und einer Vita im Schlepptau, die außer Verlusten nichts gebracht hat.
Dagegen macht der Darsteller auf der Reise von Ich zu Ich sein Theaterglück: Daniel Morgenroth. Das Deutsche Theater gehört nach wie vor den Mimen.
Sibylle Wirsing, Der Tagesspiegel, 03.05.1991
Als Sigismund („Der Turm“, Hugo von Hofmannsthal), Deutsches Theater Berlin, Regie: Thomas Langhoff
Morgenroths wundersam verstörter Sigismund verweigert sich nicht nur, als Symbol des Neuen herzuhalten für das Alte, er sieht auch ein, dass Nähe nicht möglich ist, wenn es um Königreiche und Vermögen geht. Es kann kaum ein schöneres Bild dafür geben als jenes, das Langhoff beim Treffen des Vaters mit dem Sohn inszeniert hat. Gudzuhn (…) reicht Morgenroth die Hand zum Kuss. Doch der Junge (…) will nicht unterworfen sein. Er möchte sich angenommen fühlen. Langsam, furchtsam windet Morgenroth seinen Kopf unter die offene Hand, wartet darauf, gestreichelt zu werden. Vergebens. Der Liebesentzug bedingt den Aufruhr, der Sohn fällt über den Vater her.
C. Bernd Sucher, Süddeutsche Zeitung, 12.06.1992
Juror war in diesem Jahr Albert Hetterle.

Es zeugt von kulturpolitischer Sensibilität der Stifter, das nach der Etablierung des Alfred-Kerr-Darstellerpreises mit einem grandiosen Juroren-Paar des westdeutschen Theaters zwei Ikonen der Ost-Berliner Bühnenlandschaft für das Ehrenamt gewählt wurden. Den Anfang machte 1993 mit Albert Hetterle ein Mann, dessen politische Geradlinigkeit durch einen exemplarischen Lebenslauf begründet und beglaubigt wird. Geboren am 31. Oktober 1918 in Odessa, ließ er sich am Kollektivisten-Theater seiner Heimatstadt als Eleve ausbilden und wurde 1941 nach Deutschland evakuiert. Sein beruflicher Neuanfang glückte ihm 1945 in Sondershausen, wo er vier Jahre engagiert war, ehe er über Stationen in Greifswald, Altenburg, Erfurt und Halle 1955 an das Berliner Maxim-Gorki-Theater kam. Diesem Haus und dessen Namensgeber blieb Albert Hetterle fortan lebenslang verbunden:
Als Schauspieler in „Die Letzten“, „Feinde“, „Jegor Bulytschow und die Anderen“ oder in „Barbaren“ unter der Regie des Gründungs-Intendanten Maxim Vallentin. Als Regisseur und Darsteller in „Nachtasyl“ und „Wassa Shelesowna“. Als Intendant von 1968 bis 1994. Und schließlich als Ehrenmitglied des Ensembles bis in die Gegenwart. Dass das Maxim-Gorki-Theater unter seiner Leitung zwar weiterhin der Tradition der russischen und sowjetischen Dramatik verpflichtet blieb, aber in stetiger Folge auch deutsche Klassiker produzierte und eigenwillige Regisseure wie Thomas Langhoff oder Rolf Winkelgrund förderte, ist ein unstrittiger Verdienst dieser fast drei Jahrzehnte währenden Ära.
In den 70er und 80er Jahren entdeckte und präsentierte Albert Hetterle zudem kritische Gegenwarts-Dramatik aus der Sowjetunion, die in ihrem kritischen Potenzial die Mehrheit der DDR-Autoren weit übertrafen. So wurden neben Alexander Gelmans „Protokoll einer Sitzung“, „Rückkopplung“, „Allein mit allen“ und „Wir, die Endesunterzeichnenden“ unter seiner Regie zu viel diskutierten Höhepunkten des Berliner Repertoires. Dass er schließlich zu Wendezeiten die Rolle des Wilhelm Höchst in Volker Brauns Tschechow-Paraphrase „Die Übergangsgesellschaft“ übernahm, war auch als Schutz der subversiven Zustandsbeschreibung durch die Autorität des Intendanten zu verstehen.
Nach dem Fall der Mauer rettete der erfahrene Prinzipal sein Haus und das Ensemble über die Krise, die das konfliktreiche Zusammenwachsen von Ost- und Westberliner Bühnen mit sich gebracht hatte – und öffnete das Maxim-Gorki-Theater zugleich für jüngere Autoren und Regisseure. Auf der Suche nach einem Alfred-Kerr-Preisträger aber wurde er ein Jahr vor seinem Abschied in den Ruhestand bei einem Nachbarn fündig, dessen Karriere er zu DDR-Zeiten maßgeblich gefördert hatte: Daniel Morgenroths Rolle des Sigismund in Hugo von Hofmannsthals „Der Turm“ war am Deutschen Theater Berlin vom Intendanten Thomas Langhoff inszeniert worden, der seine ersten Triumphe unter Hetterles Intendanz gefeiert hatte.
Auch im hohen Alter ist Albert Hetterle ein kindlich Staunender, ein Neugieriger, ein Listiger geblieben, der Bitteres in Humor zu kleiden – und aufzuheben vermochte. Am 17. Dezember 2006 in Berlin gestorben, besteht sein Lebenswerk nicht zuletzt darin, viele Schauspieler und Regisseure auf den Weg gebracht zu haben. Ohne Eitelkeit. Mit dieser Haltung schrieb er Theatergeschichte.
Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 1992 ist:
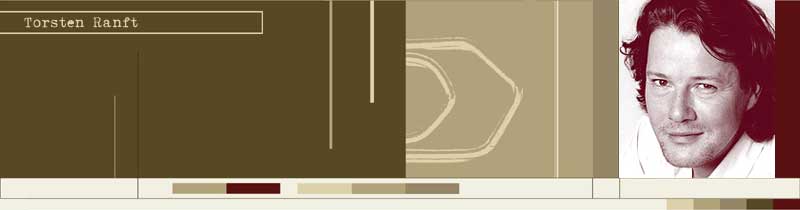
Er erhielt den Preis für die Titelrolle in „Woyzeck“ (Georg Büchner, Volksbühne Berlin, Regie: Andreas Kriegenburg).
Jahrgang 1961. Ausbildung an der Theaterhochschule „Hans Otto“ Leipzig und der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin. Schauspieler in Frankfurt/Oder, Berlin (Volksbühne), Bochum, Bremen.
Prägende Rollen (Auswahl):
Wurm (Schiller), Graf Kent (Shakespeare), Woyzeck, Danton (Büchner), Hinkemann (Ernst Toller), Macheath (Brecht),
Roelle (Marieluise Fleißer), Puntila (Brecht), Sultan Saladin (Lessing), Kowalski (Tennessee Williams),
„das Kind“ (Jelinek, „In den Alpen“). Zahlreiche Rollen im Fernsehen.
Über Torsten Ranft:
Als Woyzeck in „Woyzeck“ (Georg Büchner), Volksbühne Berlin, Regie: Andreas Kriegenburg
Kriegenburg (…) bringt die Rasierszene zeichenhaft ins Bild, wenn der Hauptmann (Ralf Dittrich) Woyzeck „im Griff“ hat und dabei die umgebundene Kinder-Trommel so schlägt, dass der Niedergedrückte bei jedem Schlag zusammenzuckt. Der junge Torsten Ranft spielt den Woyzeck unter einer Haarkappe und in ein Korsett geschnürt als einen bis ins Physische Geschädigten, deutlich Deformierten. Er bewegt sich steifbeinig trippelnd und hüpfend wie eine Puppe, ein Roboter, ein Golem.
Dieter Kranz, Berliner Rundfunk (Atelier und Bühne), 1991
Als Puntila in „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ (Brecht), Schauspiel Bremen, Regie: Michael Talke
„Und auch bei Puntilas Alkoholiker-Schizophrenie – im Suff menschelnd, nüchtern ein Despot – spielt die soziale Wirklichkeit nur die merkwürdige Rolle von etwas, das wohl sein muss, weil es im Stück steht, Torsten Ranfts Gutsbesitzer eiert und lallt eher als der eifersüchtige Schwiegervater durch das Stück, wie ihn ein guter Schwank braucht.“
Till Briegleb, Theater heute, Januar 2003
Über den Schauspieler Torsten Ranft in Bremen:
Torsten Ranft befindet sich keinesfalls auf einer einsamen Straße nach Nirgendwo. Trotzdem ist er ständig in Bewegung:
auf Reisen. Ein Schauspieler auf Reisen. Sein Leben, sein Schaffen sind aufgeteilt in Stationen – und das soll auch so bleiben… Stillstand ist Tod, sagt er. Künstlerischer Tod vor allem: “Ich bin ein Reisender“. Nie bleibe er länger als vier, fünf Jahre an einem Ort. Der Weg ist das Ziel? Im Falle von Torsten Ranft scheint es zu stimmen. Temporäre Heimstatt des 42-jährigen gebürtigen Leipzigers ist derzeit das Bremer Theater. (…) Kriegenburg, Haußmann, Castorf – Regisseure, die ihn und seine Arbeit bisher prägten. „Für mich ist … die künstlerische Partnerschaft wichtig.“ Aus der will er gewinnen, die müsse ihm alles abverlangen und sie müsse eben beidseitig sein. „Die Kommunikation, die Chemie muss stimmen.“ Irgendwie wundert jene Einstellung kaum bei einem Mann, der sich selbst als Besessenen beschreibt: „Ich kann gar nicht anders als Schauspieler zu sein. Das steckt einfach in mir und das muss raus, sonst platze ich!“
Daniela Barth, Bremer Zeit Kultur, 2003
Jurorin war in diesem Jahr Marianne Hoppe.
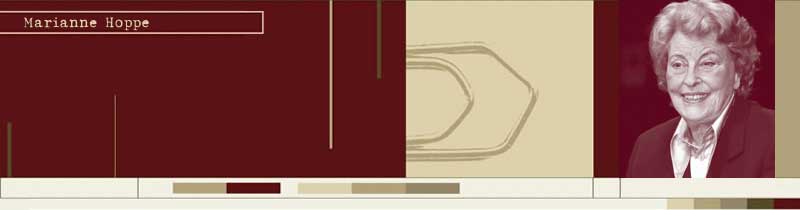
Mit Marianne Hoppe wurde 1992 programmatisch eine Grande Dame des deutschen Sprechtheaters zur zweiten Jurorin des Alfred-Kerr-Darstellerpreises berufen. Am 26. April 1909 in Rostock geboren und auf dem elterlichen Gut Felsenhagen in der Mark Brandenburg aufgewachsen, bewarb sich Marianne Hoppe bereits als 17-Jährige erfolgreich an der Schauspielschule des Deutschen Theaters Berlin, das damals von Max Reinhardt geleitet wurde. Nach ihrem Debüt an der Bühne der Jugend folgten zwei arbeitsreiche Jahre am Neuen Theater in Frankfurt am Main sowie ein kurzes Engagement an den Münchner Kammerspielen unter der Intendanz von Otto Falckenberg, ehe die Künstlerin 1933 ihre Heimat 1933 am Staatlichen Schauspielhaus Berlin fand.
Parallel wurde sie von der Ufa entdeckt, die Hoppes markante Erscheinung vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges u. a. in so erfolgreichen Filmen wie „Der Schimmelreiter“, „Eine Frau ohne Bedeutung“ und „Kapriolen“ präsentierte.
Da Marianne Hoppe von 1936 bis 1946 mit ihrem Kollegen und Intendanten Gustaf Gründgens verheiratet gewesen war und mit großen Rollen wie Lessings Minna von Barnhelm oder Emilia Galotti das Staatstheater der Nationalsozialisten geprägt hatte, musste sie nach 1945 Umwege auf die Bühne suchen. Sie arbeitete als Rundfunksprecherin und in einem Flüchtlingslager, ehe ihr geschiedener Mann ab 1947 ein Comeback am Düsseldorfer Schauspielhaus ermöglichte. Parallel zu dieser Verpflichtung ging sie in der Saison 1951/52 ein Engagement am Deutschen Schauspielhaus Hamburg ein, ab 1955 entschied sie endgültig für freischaffende Arbeit vor allem in Berlin.
Nachdem die Schauspielerin in ihrem sechsten Lebens-Jahrzehnt von jüngeren Autoren und Regisseuren entdeckt worden war, entstand ein staunenswertes Alterswerk: Marianne Hoppe brillierte nicht nur als Protagonistin in Stücken von Thomas Bernhard („Die Jagdgesellschaft“, „Am Ziel“, „Heldenplatz“) und Tankred Dorst („Chimborazo“), sondern inspirierte Robert Wilson auch zu seiner Frankfurter Inszenierung des „König Lear“. In ihrem letzten Lebensjahrzehnt adelte sie mit ihrer Grandezza und Präzision, aber auch mit ihrer lakonischen Selbstironie vor allem Texte und Inszenierungen von Heiner Müller, der sie sowohl in seinem „Quartett“ als auch in Brechts „Arturo Ui“ besetzte. Die letzte Begegnung mit diesem Dichter arrangierte 1996 Frank Castorf, als er die 87-Jährige am Berliner Ensemble für „Der Auftrag“ gewinnen konnte.
Dass Werner Schroeters Porträt-Film „Die Königin“ im Jahr 2001 jenen Titel prägen sollte, den Marianne Hoppe nach ihrem Tod am 23. Oktober 2002 auch von Künstler-Kollegen wie Claus Peymann verliehen bekam, ahnte zum Zeitpunkt dieser letzten Premiere noch niemand. Zehn Jahre zuvor hatte die Majestät bereits einen jungen Schauspieler geadelt:
Als Jurorin des Alfred-Kerr-Darstellerpreises zeichnete sie Torsten Ranft für die Titelrolle in Büchners „Woyzeck“
an der Berliner Volksbühne (Regie: Andreas Kriegenburg) aus.
Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 1991 ist:
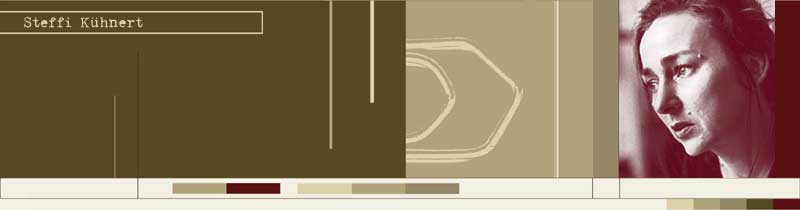
Sie erhielt den Preis für die Titelrolle in „Nora“ (Henrik Ibsen, Deutsches Nationaltheater Weimar, Regie: Leander Haußmann).
Jahrgang 1963. Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin, Schauspielerin in Eisenach, Weimar, Berlin (Schiller-Theater), Wien, Bochum, München und bei den Salzburger Festspielen sowie am Deutschen Theater Berlin. Jahrelange enge Zusammenarbeit mit Leander Haußmann.
Prägende Rollen (Auswahl):
Nora (Ibsen), Antigone (Sophokles) Elisabeth (Schiller), Natascha (Tschechow), Katharina, Ariel, Hermia (Shakespeare).
Über Steffi Kühnert:
Als Nora in „Nora“ (Henrik Ibsen). Deutsches Nationaltheater Weimar, Regie: Leander Haußmann
Die Nora Steffi Kühnerts ist eine Figur wie aus einer frühen Collage Max Ernsts: ein heftiges Temperament, von großer Nervosität, etwas Panisches in den Augen, den Gesten, den Gängen. Angst erfasst sie körperlich.
Peter Iden, Jahrbuch Theater heute, 1991
Steffi Kühnert vermittelt die Gespanntheit, die künstlich erzeugte Energie der jungen Frau mit begeisterndem Einsatz, ihr Tanz, bis zur physischen Erschöpfung geführt, wird zur lodernden Anklage. Die Getriebenheit, die Künstlichkeit des Geschöpfs wandelt sich dann in eine gelassene Härte, in gemessene Würde.
Christoph Funke, Der Morgen, 16.05.1991
Als Ariel in Shakespeares „Der Sturm“, Berliner Ensemble, Regie: Leander Haußmann
Steffi Kühnert schwebt, fliegt und irrlichtert als Ariel wie ein Seiltänzer durch die Manege. Für die Bodenhaftung des Luftgeistes sorgen die aufgepumpten Gummischläuche, in denen die Schauspielerin steckt wie ein Michelin-Männchen. Sie geben ihren Flugkünsten die Erdenschwere eines Lastwagens. Und es ist, als hätte der Regisseur ihr wie allen Beteiligten eingeschärft:
Nur nicht abheben! Wir machen Musik, wir zaubern wie im Zirkus, aber wir bleiben auf dem Boden des alten Brecht-Theaters,
das seine Mittel immer auch sichtbar macht.
Frank Busch, FAZ, 2003
Juror war in diesem Jahr Bernhard Minetti.
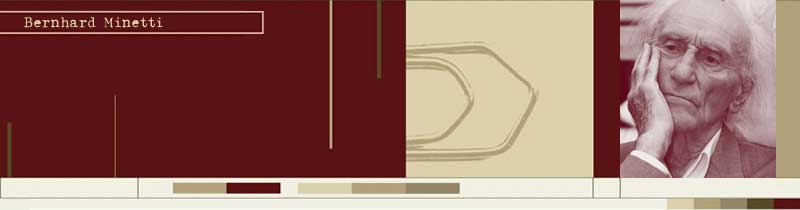
Mit Bernhard Minetti wurde 1991 einer der Überväter des bundesdeutschen Theaters zum ersten Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreises berufen. Am 26. Januar 1905 in Kiel als Sohn eines Architekten geboren, hatte Minetti 1925 bis 1927 die Staatliche Schauspielschule von Leopold Jessner in Berlin besucht, um danach am Reussischen Theater Gera zu debütieren.
Zum Star wurde er ab 1928 in Darmstadt, wo er sich in Rollen wie Hamlet und Don Carlos das große klassische Repertoire erschloss. Parallel zu seinem Engagement am Preußischen Staatstheater in Berlin, wo er bis zu dessen Schließung 1944 Parade-Partien wie Faust, Robespierre, Wallenstein und Franz Moor spielte, arbeitete Bernhard Minetti ab 1930 auch für den Film – unter anderem in „Berlin-Alexanderplatz“ und in „Der Mörder Dmitri Karamasow“.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ging Bernhard Minetti zunächst nach Kiel, wo er auch als Schauspieldirektor arbeitete. Einem zweijährigen Engagement am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg folgte eine Zeit als freischaffender Künstler, ab 1952 ging der gefragte Künstler ein vierjähriges Engagement in Frankfurt am Main ein. Nach einem Intermezzo in Düsseldorf arbeitete er wieder frei und konzentrierte sich dabei zunehmend auf die Westberliner Bühnen.
Während Bernhard Minetti den Kritikern jener Zeit vor allem als Ideal-Interpret für die Theater-Texte von Beckett, Genet, Dürrenmatt, Strindberg und Pinter galt, begann seine staunenswerte Alters-Karriere in den 70er Jahren mit Stücken von Thomas Bernhard. Nach “Jagdgesellschaft” und “Die Macht der Gewohnheit” widmete der Autor seinem bevorzugten Darsteller 1976 das Solo “Minetti – Ein Porträt des Künstlers als alter Mann”. In den 80er Jahren spielte Minetti bei Regisseuren wie Claus Peymann (“Der Weltverbesserer”, “Der Schein trügt”), Peter Zadek (“Jeder stirbt für sich allein”), Klaus Michael Grüber (“Faust”, “König Lear”) und Hans Neuenfels (“Der Balkon”). Eine schwere Zäsur bedeutete für den Jahrhundert-Schauspieler 1993 die Schließung des Berliner Schillertheaters, wo er zuletzt als Puck im “Sommernachtstraum” gefeiert worden war. Seine Klage gegen die mit dieser kulturpolitischen Bankrott-Erklärung verbundene Kündigung wurde vom Bühnenschiedsgericht Berlin zurückgewiesen, später entschuldigte sich die Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, Hanna-Renate Laurien, öffentlich für den “Mangel an menschlicher Kultur”.
Im Alter von 90 Jahren unterschrieb Bernhard Minetti, der in der Kritiker-Umfrage von „Theater heute“ siebenmal zum „Schauspieler des Jahres” gewählt wurde, noch einmal einen Vertrag am Berliner Ensemble, wo er bald darauf in Heiner Müllers letzter Inszenierung „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ als Schauspiellehrer eine der Sternstunden der Theaterkunst kreierte.
Kurz vor seinem Tod war er am selben Ort in Robert Wilsons „Der Ozeanflug“ zu sehen. Bernhard Minetti, der in der Kritik als „biologisch-künstlerisches Wunder“ gefeiert worden war und dessen reife und vollendete Menschendarstellung Generationen von Künstlern inspirierte, starb am 12. Oktober 1998 in Berlin.
Als Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreises wählte Bernhard Minetti 1991 – zwei Jahre nach dem Fall der Mauer – die junge ostdeutsche Schauspielerin Steffi Kühnert für ihre Rolle in Leander Haußmanns „Nora“-Inszenierung am Deutschen Nationaltheater Weimar.